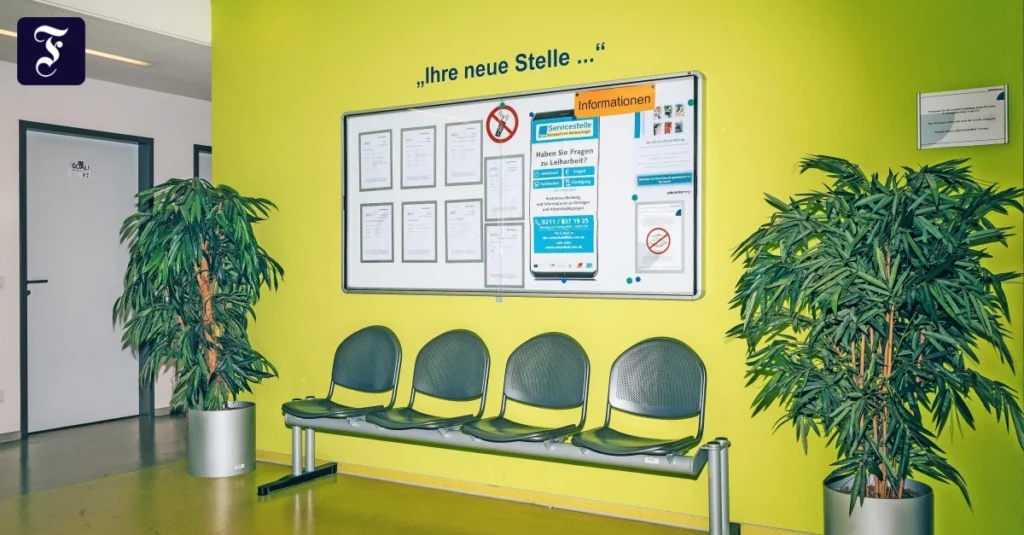

Erstes Gespräch: Timo V. und Vermittlerin Lisa Möller
Die Uhr zeigt 9.39. Eigentlich war das Gespräch für zehn Uhr geplant, aber Timo V. wartet mit seiner Freundin bereits vor der Tür, überpünktlich. Es ist ein Erstgespräch, Vermittlerin und „Kunde“ haben sich noch nie gesehen. Lisa Möller bittet die beiden herein. Sie setzen sich auf die Stühle am anderen Ende des Schreibtischs. Timo V. hat eine Hülle mit Unterlagen in der Hand. Er ist vielleicht dreißig Jahre alt. Seine Augen sind ungewöhnlich starr.
Auf das, was nun kommt, ist Vermittlerin Möller zumindest etwas vorbereitet. Sie kennt die Eckpfeiler der Vita von Timo V. Die Psychologen haben ein Gutachten an das Jobcenter geschickt. Timo V. redet ohnehin nicht lange herum: Vor einigen Monaten stürzte er sich aus einem brennenden Haus. Er sei aus dem Fenster gesprungen. Es sei ein Unfall gewesen. Seinen Schwiegervater habe er nicht retten können, sagt er immer wieder. Der ist an jenem Tag gestorben. In seiner Hülle mit Unterlagen steckt der ausgedruckte Bericht eines Fernsehsenders über den Unglückstag. Timo V. reicht ihn der Vermittlerin. In einer Wohnung gab es einen Küchenbrand; am Schluss stand das ganze Mehrfamilienhaus in Flammen. Die genaue Ursache bleibe unklar, heißt es, alles deute auf einen Unfall hin. Ein Bewohner habe sich mit einem Sprung aus dem ersten Stock gerettet und sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.
Vermittlerin Möller hört zu und gibt Timo V. Zeit, um zu erzählen. Immer wieder kommt er auf diesen Tag zu sprechen, was für Traumatisierte nicht ungewöhnlich ist. Seine Geschichte berührt auch die Vermittlerin. Timo V. springt von einem Punkt seines Lebens zum anderen, verliert sich in Details, schwenkt von der Kindheit zur psychischen Erkrankung der Mutter, zur Ausbildung zum Maler und Lackierer. Er erzählt, dass er in seinem Beruf keine Stelle gefunden hatte, und von unsicheren Arbeitsverhältnissen. „Zeitarbeit ist Schwachsinn“, sagt er. „Immer mal ’ne Woche oder zwei, und dann schmeißen die einen von heut’ auf morgen raus.“
Die Spuren, die der Sprung aus dem Haus hinterlassen hat, begleiten ihn, körperlich und psychisch. Als ihn die Vermittlerin auf seinen Gesundheitszustand anspricht, hebt er unvermittelt das T-Shirt und zeigt den Ring, der seinen Rücken stabilisiert. Und er sagt: „Die Bilder kommen immer wieder hoch, vor allem wenn es ganz still ist.“ Seine Ärzte raten ausdrücklich davon ab, dass Timo V. derzeit eine Arbeit aufnimmt. Er solle erst mal eine Therapie machen, heißt es in der Empfehlung, die Möller auf ihrem Computer geöffnet hat. Beworben hat Timo V. sich trotzdem. Er wolle zeigen, dass er nicht nur auf der faulen Haut liege, erklärt er der Arbeitsvermittlerin. Doch auch Möller rät ihm vorerst von der Stellensuche ab. Sie gibt ihm Anlaufstellen für Therapieangebote an die Hand und druckt eine Broschüre aus.
Fast zehn Jahre lang hat Timo V. in die Arbeitsversicherung eingezahlt, deshalb bekam er Arbeitslosengeld (ALG). Weil das in seinem Fall zu niedrig war, wurde es mit Bürgergeld aufgestockt. Nun ist sein Anspruch auf Arbeitslosengeld beendet. Timo V. ist ganz auf Bürgergeld angewiesen. Bewilligt ist das Bürgergeld für ein Jahr, dann muss man weitersehen. Möller wird diesem „Kunden“ noch häufiger begegnen.
Das Gespräch war harte Kost, selbst für eine erfahrene Vermittlerin wie sie. Möller mag an ihrer Arbeit, dass man so intensiv in die Biographien „eintauche“. Der Fall von Timo V. sei ein gutes Beispiel, sagt die Vermittlerin: Es gehe in erster Linie immer um soziale Probleme, um Krisen, dann komme die Vermittlung. Manche Leute würden während der Gespräche weinen. „Man macht das ganze Weltgeschehen mit“, sagt Möller. Sie habe erlebt, wie Afghanen nach der Rückkehr der Taliban nicht mehr geradeaus denken konnten, weil sie Angst um ihre Familien hatten. Und nun gebe es eben die Ukraine.
Sie kenne auch die Fälle, um die sich die öffentliche Debatte drehe, sagt Möller: „Es gibt Kandidaten, die nie kommen. Interessanterweise sind das bei mir nur Deutsche.“ 170 Fälle – oder Kunden – betreut sie. Davon erschienen acht nie. Dieser Gruppe sollen die Leistungen künftig schneller gestrichen werden können. Aber es komme auch immer darauf an, wo man sich befinde, sagt Möller. Vor Frankfurt habe sie in Würzburg gearbeitet. „Da ist das hier schon eine andere Hausnummer.“ In ihrem ersten Monat in Frankfurt sei eine Frau in einem Jobcenter erschossen worden. Das, was sie einmal gelernt habe, sei nicht so richtig hilfreich. „Verwaltungsausbildung ist hier nicht gefragt“, sagt Möller. Aber das mache ihren Job auch aus.
Zweites Gespräch: Florian A. und Vermittlerin Nina Popow
Dass der junge Mann heute überhaupt erscheint, damit hätte Vermittlerin Popow nicht gerechnet. Dabei ist sie niemand, der sich gerne auf der Nase herumtanzen lässt. „Meine Fälle spuren!“, sagt die durchsetzungsstarke Frau und lacht. Popows Akzent ist russisch. „Das hilft manchmal“, sagt sie: Auch sie habe eine Migrationsgeschichte und teile so manche Erfahrung mit den Kunden. Den 25 Jahre alten Florian A. auf der anderen Seite des Schreibtischs hat Popow noch nie gesehen. Für ihn war bis jetzt das Jugendjobcenter zuständig. Das hat sich nun geändert. Die vorherigen drei Termine hatte Florian A. verstreichen lassen.
„Warum sind Sie denn nicht gekommen?“, fragt die Vermittlerin. „Weil der alte Mann schnarcht!“, gibt Florian A. zurück. In der Unterkunft hätten sie schon Streit gehabt deswegen. „Wenn ich meinen Schlaf nicht bekomme, kann ich den Termin nicht wahrnehmen.“ Die Termine lagen früh, teils um acht Uhr. Das verschlafe er nun mal, wenn er die ganze Nacht wachgehalten werde. Wie genau Florian A. wohnt, bleibt unklar. Mal spricht er von der „Notunterkunft“, mal vom „Hotel“.
Florian A. besuchte nach der Grundschule die Hauptschule, dann eine Förderschule. Die achte Klasse brach er ohne Abschluss ab. Die schulische Erfahrung beschreibt er noch heute negativ. Er sei nicht mitgekommen und habe von anderen Kindern viel abbekommen. Aber den Abschluss habe er nachgeholt – „Glückwunsch“, sagt Popow – und will nun einen Gabelstaplerschein machen. Das könnte das Jobcenter als Arbeitsmaßnahme fördern. Da hakt die Vermittlerin ein. „Machen Sie doch eine richtige Ausbildung“, sagt Popow.
„Ne, da verdient man wenig, außerdem habe ich keine Lust, drei Jahre zu lernen“, sagt Florian A. Er habe auch so immer gearbeitet, der Mutter eines Freundes gehöre eine Gastrokette. „Aber Gastro ist scheiße.“ Man werde nur von A nach B gescheucht. „Der eine Chef sagt, mach mal das. Man läuft rüber, dann sagt der andere: Schäl’ Kartoffeln. Irgendwann stand ich da und hab’ gebrüllt: Ich bin nicht euer Hund.“
Popow hakt wieder ein: „Machen Sie eine Kochausbildung, dann können Sie überall auf der Welt arbeiten.“ Florian A.s Gesichtsausdruck wirkt herausfordernd: „Dann stehe ich jeden Tag für sechs bis sieben Euro im Chinarestaurant.“ Die Vermittlerin bleibt hartnäckig. „Sie könnten auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten.“ Es gehe ihr immer auch darum, die Vorstellungskraft anzuregen, sagt sie nach dem Vermittlungsgespräch. Bei Florian A. zieht das nicht.
„Ich war letztens schon in Dubai drei Wochen.“ Wie er sich das denn finanziert habe, will Popow wissen. „Mein Kumpel ist DJ, der hat gezahlt.“ Popow erinnert ihn daran, dass er im Jahr nur 21 Tage Urlaub machen dürfe, solange er Bürgergeld bezieht. „Und Sie rufen dann jeden Tag an?“, hört sie als Antwort.
Eigentlich frage sie nicht so nach Geld, berichtet die Vermittlerin im Nachhinein, das sei schließlich auch Privatsache. Aber sie müsse sich ein Bild über die Situation machen. Von einer Ausbildung kann sie ihren Kunden Florian A. an diesem Morgen nicht überzeugen. Das mit dem Gabelstaplerschein scheint gesetzt zu sein. Damit könne er nachts am Flughafen arbeiten und tagsüber schlafen, wenn der schnarchende Mitbewohner wach ist, sagt Florian A. Außerdem gebe es nachts mehr Geld. Eine Absage für diese Weiterbildung erteilt ihm Popow nicht. Bis zum nächsten Mal soll er sich über die Arbeit am Flughafen informieren. So halten sie es im Kooperationsplan fest. Angesetzt ist der Termin in zwei Wochen. Diesmal am Nachmittag.
Drittes Gespräch: Kundin Y. und Vermittlerin Kerstin Wolf
Noch beim Eintippen der Festnetznummer dämpft Kerstin Wolf die Erwartungen. Sie werde vermutlich ohnehin niemanden erreichen, aber sie wolle es einmal versuchen. Die „Kundin“ wurde ihr vor Kurzem zugeteilt, nun will die Vermittlerin klären, ob die Situation noch den Akten entspricht. Es klingelt einige Male durch den Lautsprecher. Wolf bleibt geduldig. Aller Erwartung zum Trotz meldet sich eine Frauenstimme.
Von Anfang an hat das Gespräch eine Schieflage. Die Kundin Y. spricht kaum Deutsch, die Begrüßung ihrer Vermittlerin kann sie schlicht nicht verstehen. Nach dem zweiten Versuch gibt die Frau den Hörer ab. Ihre Tochter übernimmt, sie spricht freundlich und in akzentfreiem Hochdeutsch. Auf die Fragen, die es zu klären gilt, kann sie für ihre Mutter antworten.
Ihre Kundin, das wusste Vermittlerin Wolf schon aus den Unterlagen, ist weit mehr als fünfzig Jahre alt. Zwanzig Stunden in der Woche arbeitet die Frau in einer Reinigung, den Rest der Zeit pflegt sie ihren Mann. Damit ist sie ausgelastet. So sieht es auch das Jobcenter. Aber mit dem Teilzeitjob bleibt am Monatsende zu wenig. Was an Geld zum Leben fehlt, kompensiert das Jobcenter mit Bürgergeld. Auf diese „Aufstockung“ ist die Familie angewiesen.
„Jeder hat einen Rucksack zu tragen, sonst wären die Leute nicht hier“, sagt Vermittlerin Wolf. Oft seien die Rahmenbedingungen schwierig, daran könne in vielen Fällen niemand etwas ändern. „Wie soll man Leute vermitteln, die nur von neun bis zwölf Uhr eine Kinderbetreuung haben?“ Andere seien so hoch verschuldet, dass ihnen nichts vom Einkommen bleibe, da müsse dann erst mal ein Schuldenberater ran. Die hohen Mieten in manchen Gegenden seien da nicht hilfreich.
Mit den meisten ihrer Kunden verliefen die Gespräche gut, sagt Wolf. „Manche wollen sich auch einfach mal auskotzen.“ Vermittlung sei zu großen Teilen auch Sozialarbeit, aber dem seien durch das Gesetz klare Grenzen gesetzt. „Bei einigen Dingen können und dürfen wir nicht helfen. Das ist auch richtig so.“ Wo diese Grenzen genau verlaufen, sagt sie nicht.
Nach ein paar Minuten am Telefon hat die Vermittlerin die Informationen beisammen, die sie wollte. Die Tochter hat ihr bereitwillig alles erzählt. Wie es derzeit bei der Mutter laufe, welche Pflegestufe ihr Vater nun habe und so fort. Um den geforderten Pflegenachweis werde sie sich kümmern, verspricht die Tochter. Dann legen beide Frauen auf.
Die Gespräche fanden regulär und unabhängig von der Berichterstattung statt. Die Namen aller Beteiligten wurden geändert.
