
„Ich wurde in Warschau in eine Lehrerfamilie geboren. Ich habe Pierre Curie geheiratet und zwei Kinder bekommen. Und meine Arbeit habe ich in Frankreich verrichtet“: Marie Curie selbst war mit ihrer Autobiographie schnell fertig. Wenn es denn unbedingt sein müsse, könne sie die Lebensgeschichte ihres Mannes schreiben, aber in der Wissenschaft gehe es doch um die Phänomene, nicht um die Personen, beschied sie Reportern, die sie belagerten und von der Arbeit abhielten, nachdem sie ihren ersten Nobelpreis gewonnen hatte.
Natürlich gibt es über das beeindruckende und außergewöhnliche Leben der polnisch-französischen Physikerin und Chemikerin viel zu berichten, das belegen bereits mehrere Biographien, beginnend mit dem 1937 erschienenen Band „Madame Curie“, verfasst von ihrer zweiten Tochter, Ève. Dava Sobel, langjährige Wissenschaftsredakteurin bei der „New York Times“, hat für ihre Curie-Biographie nun einen neuen Anknüpfungspunkt gesucht: die Forscherinnen, die mit ihr zusammen in ihrem Labor in Paris geforscht haben.
Frühmorgens las sie Fachbücher auf Französisch und Russisch
In „Längengrad“, dem Buch, mit dem Sobel bekannt wurde, stand „ein einsames Genie“ im Mittelpunkt, es arbeitete an einem perfekten Chronometer. In „Galileos Tochter“ und „Das Glas-Universum“ hatte die Autorin die Aufmerksamkeit bereits auf Frauen gelenkt, die in der Wissenschaftsgeschichte viel zu lange ignoriert worden waren. Nun betrachtet sie Marie Curie als Forscherin, die anderen Frauen den Weg ebnete. Denn ihr Ruf zog viele Forscherinnen nach Paris, nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus Polen, Curies Heimatland, aus England, Schweden und Kanada. Sie nahmen sich die Forscherin, die immer wieder als klein, bescheiden und traurig beschrieben wurde, zum Vorbild: eine Frau, die es geschafft hatte, in der Männerwelt der Wissenschaft Karriere zu machen. Die wichtigsten dieser Mitarbeiterinnen geben nun den Kapiteln in Dava Sobels Curie-Biographie ihre Namen.
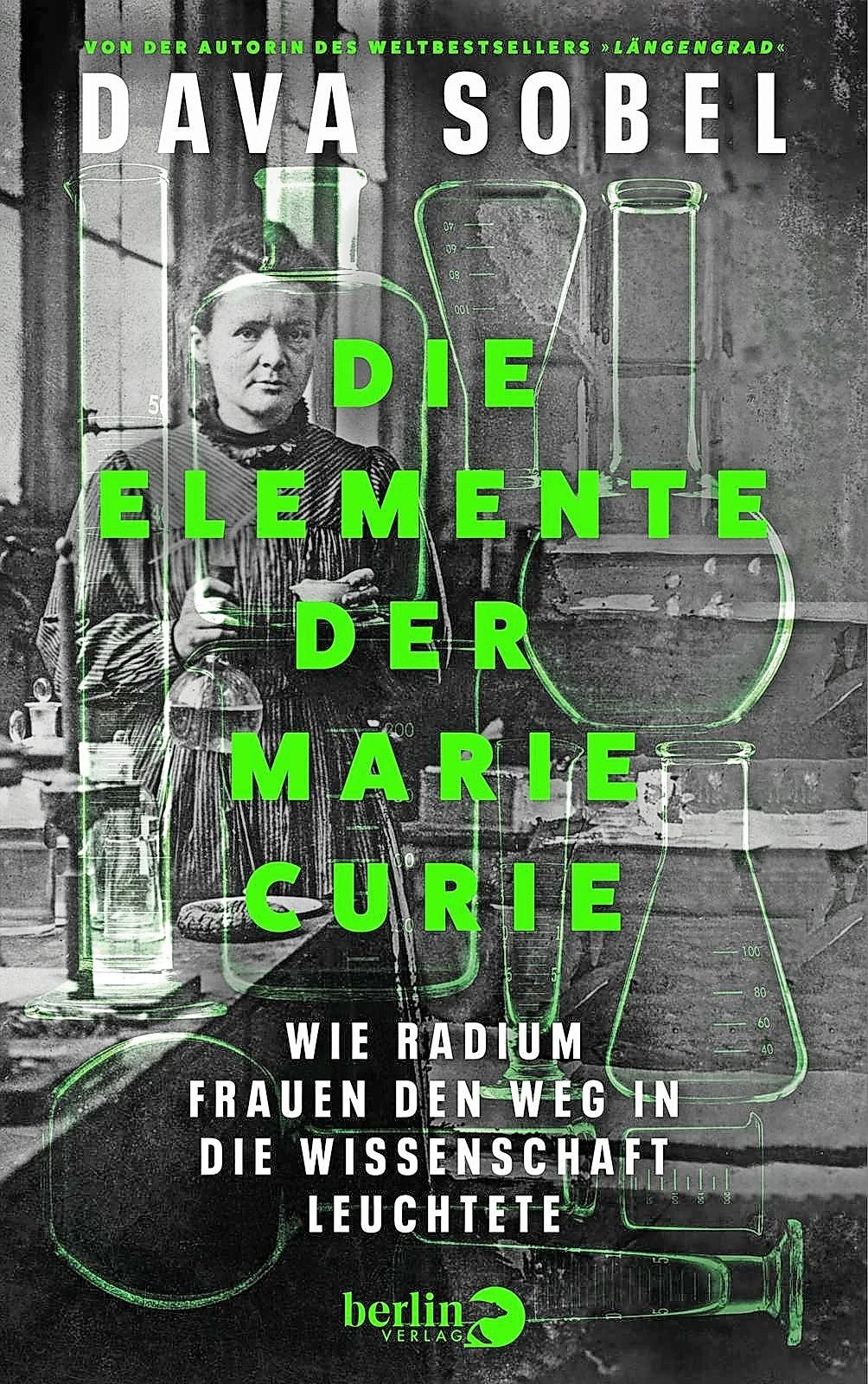
Leider allerdings nicht viel mehr als ihre Namen. Denn Marie Curie steht ganz eindeutig im Zentrum dieses Buches. Sobel berichtet, wie Frankreich den bildungshungrigen Curie-Schwestern zum Ziel ihrer Träume wird, denn dort durften sie, anders als in Polen, immerhin studieren. Sie schmieden einen Pakt: Zuerst würde Bronia, die ältere, nach Paris gehen, um Medizin zu studieren. Wenn sie dann Geld verdiente, käme Marie nach, könne bei ihr wohnen und sich selbst in die Wissenschaften stürzen. So geschieht es. Bis sie nach Paris ziehen kann, jobbt Marie als Hausmädchen, liest frühmorgens und spätabends Fachbücher auf Französisch und Russisch und löst zur Entspannung „algebraische und trigonometrische Aufgaben“. Als sie sich endlich an der Sorbonne einschreiben kann, ist sie eine von 23 Frauen unter zweitausend Männern.
Anders als die wenigen anderen Frauen ihrer Generation, die in Forschung oder Lehre tätig sind, arbeitet sie auch nach der Heirat mit Pierre Curie weiter. Sie forscht mit ihm zusammen: erst zu Magneten und den Eigenschaften von Stahl, dann über die erst vor Kurzem entdeckte „Energiequelle“ Uran. Sie untersucht andere Materialien auf die eigentümliche Strahlung und findet zuerst ein Element, das sie Polonium tauft, später das Radium. Auch die Bezeichnung „radioaktiv“ geht auf eine Arbeit der beiden Curies zurück. Sie wird schnell aufgenommen, die Forscherinnen und Forscher, die auf diesem Gebiet arbeiten, heißen bald „Radioaktivisten“.
Wie bei den Alchemisten?
Ausführlich schildert Sobel, wie unglaublich aufwendig und kräftezehrend deren Forschung zu Beginn war, wie viele Tonnen Material verarbeitet werden mussten, um wenige Milligramm radioaktiver Substanz zu isolieren, noch dazu in einem unbeheizten, zugigen Schuppen, oft mit von der Strahlung verbrannten Fingerkuppen. Vielen Zeitgenossen erschien das Feld rätselhaft und bisweilen unseriös: Sollte es wirklich Elemente geben, die sich durch die Abgabe von Strahlung verwandelten, die im Periodensystem der Elemente nicht da blieben, wo sie einsortiert waren? Klang das nicht nach Transmutation, wie bei den Alchimisten?
Sobel zeigt, wie sich die zeitgenössischen Arbeiten zu Atomphysik, Röntgenstrahlung und Radioaktivität ergänzten, wie Hoffnungen aufkamen, man habe mit der Radiostrahlung ein Mittel zur Behandlung von Krebs gefunden, und wie man erst nach und nach erkannte, dass der Umgang mit den radioaktiven Stoffen auf die Dauer selbst Krebs verursachte.
Natürlich schildert Sobel auch all die Hindernisse und Widrigkeiten, mit denen die Forscherin zu kämpfen hatte, weil sie eine Frau war: Als sie einen Preis für ihre Entdeckungen bekommt, beglückwünscht man ihren Mann mit der Bitte, sie zu informieren. In der Preisurkunde wird sie „Monsieur“ genannt. Ihren ersten Nobelpreis teilt sie sich mit ihrem Mann, eigentlich sollte nur er ausgezeichnet werden, aber er bestand darauf, dass auch ihre Arbeit gewürdigt wird. Marie Curies zähe Auseinandersetzung mit der Männerwelt zieht sich durch ihre Biographie, auch dann noch, als sie längst eine internationale Berühmtheit ist, ein großes Labor leitet und mit vielen Größen der Wissenschaft bekannt und befreundet ist. Immer wieder ist sie die einzige Frau auf dem Kongress, beim Empfang, auf dem Foto.
Brooks sagte die Hochzeit ab, um zu den Radioaktivisten zu gehen
Das alles ist beeindruckend zu lesen. Es ist so beeindruckend, dass die Geschichten der Mitarbeiterinnen, die die besondere Perspektive von Dava Sobels Biographie bilden sollten, daneben seltsam blass bleiben. Von kaum einer dieser Mitarbeiterinnen erfährt man mehr als ein bisschen biographischen Hintergrund und ihre Aufgaben im Labor. Viele mussten sich, wie Marie Curie, ihren Weg in die Wissenschaft erkämpfen, manche heirateten nie und blieben in der Forschung, andere mussten sich zwischen Familie und Karriere entscheiden. Nur ganz wenige hatten das Glück, wie Marie, nicht nur trotz, sondern mit Unterstützung ihres Mannes weiter forschen zu können.
Die Kanadierin Harriet Brooks, eine der wenigen, die in der Biographie ein wenig plastischer werden, arbeitete als Dozentin an der Columbia University, bis sie, kurz vor ihrer Hochzeit, von ihrem Dekan einen Brief erhielt, in dem ihr erklärt wurde, als verheiratete Frau könne sie nicht Dozentin sein. Denn dann würde sie entweder ihre beruflichen Pflichten oder ihren Ehemann vernachlässigen, und beides könne man nicht dulden. Sie sagte die Hochzeit ab, kündigte und ging zu den Radioaktivisten nach Paris.
Doch diese Frauen kommen und gehen und hinterlassen beim Lesen kaum einen eigenen Eindruck. Selbst über ihr Verhältnis zu Marie Curie erfährt man nicht viel. Sie komme nicht oft zu den Studenten, sei aber sehr freundlich, wenn diese sie aufsuchten, ansonsten sei sie vor allem mit ihrer Forschung beschäftigt, berichtet etwa May Sybil Leslie. Die Engländerin war 1909 nach Paris gekommen und forschte an Thorium. Sichtbarer werden lediglich Marie Curies Töchter, vor allem die ältere, Irène, die erst mit ihr zusammenarbeitete, später ihr Labor übernahm und auch selbst einen Nobelpreis erhielt. Dava Sobel hat eine materialreiche, gut zu lesende Biographie von Marie Curie geschrieben, in der die Hauptnebendarstellerinnen allerdings zu kurz kommen.
Dava Sobel: „Die Elemente der Marie Curie“. Wie Radium Frauen den Weg in die Wissenschaft leuchtete. A. d. Englischen von G. Schermer-Rauwolf und R. A. Weiß. Piper Verlag, München 2025. 384 S., geb., 26,– €.
