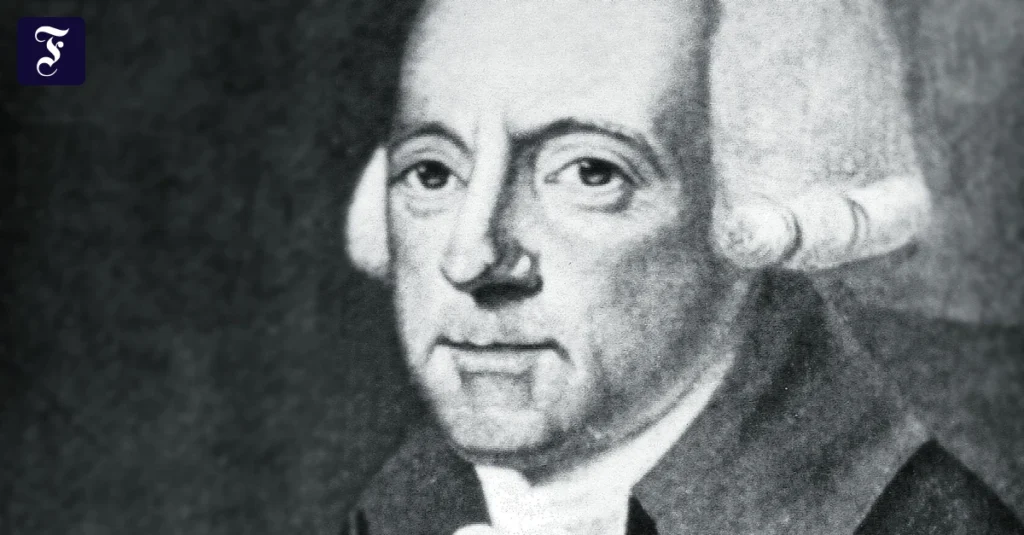
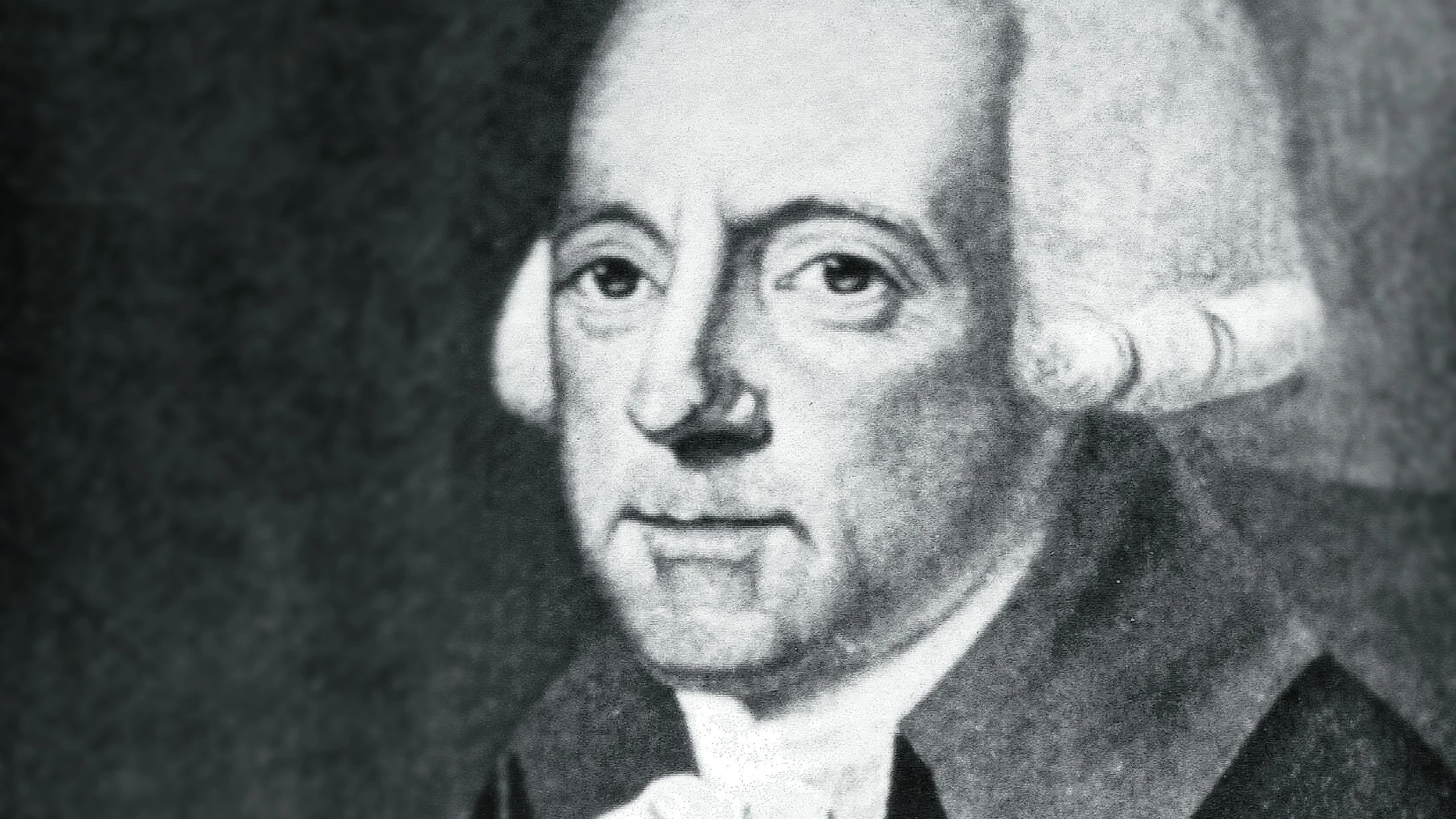
Vermutlich war an diesem Tag niemandem bewusst, dass eine neue Epoche der Weltgeschichte begann. Am 8. März 1776 wurde das kleine Städtchen Tipton in den englischen Midlands „der wichtigste Ort der Welt“, wie die Lokalzeitung sehr viel später schrieb. Das örtliche Kohlebergwerk nahm an diesem Tag eine Apparatur in Betrieb, die in der Lage war, vergleichsweise große Wassermengen aus den Stollen zu pumpen. Damit kam die erste effiziente Dampfmaschine im modernen Sinn endlich zu ihrem praktischen Einsatz, entworfen von dem schottischen Erfinder James Watt.
Tags darauf erschien in London ein ähnlich revolutionäres Produkt, gleichfalls von einem Schotten verfasst: Der mit Watt befreundete Moralphilosoph Adam Smith veröffentlichte sein Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ im Verlag von William Strahan und Thomas Cadell. Es enthielt ziemlich neuartige Gedanken, wie sich das Leben und Wirtschaften der Menschen auch ohne feudale Abhängigkeiten organisieren ließe – und warum von einem freien Handel am Ende alle profitieren könnten. Das Buch über den „Wohlstand der Nationen“ habe „vielleicht mehr Einfluss auf das Denken und Handeln der Kulturvölker gehabt“, urteilte der Wiener Philosoph Friedrich Jodl schon am Ende des 19. Jahrhunderts, „als irgendein anderes Werk dieser an neuen und fruchtbaren Gedanken so reichen Zeit“.
Die beiden Verleger hatten beste Verbindungen und einen guten Riecher, jedenfalls brachten sie innerhalb weniger Wochen gleich zwei Jahrhundertwerke heraus. Das andere war am 17. Februar erschienen, es trug den ähnlich wuchtigen Titel „Verfall und Untergang des Römischen Imperiums“. Auch das Buch des englischen Historikers Edward Gibbon war ein Lob auf einen eng vernetzten Wirtschaftsraum, der aus einem Mangel an Pragmatismus zugrunde gegangen war: Gibbon sah im Aufstieg des intoleranten Christentums eine der Hauptursachen für das Ende der antiken Globalisierung und den daraus resultierenden Wohlstandsverlust.
Zusammenhang zwischen Unabhängigkeitserklärung und Smith?
Wenige Monate später folgte jenseits des Atlantiks in Philadelphia ein Ereignis, das im kollektiven Gedächtnis weit präsenter ist als die Großtaten der drei Schotten Watt, Smith und Gibbon: Die Delegierten der britischen Kolonien in Nordamerika verabschiedeten am 4. Juli im Pennsylvania State House einen Text, mit dem sie sich von der englischen Krone lossagten und universelle Freiheitsrechte propagierten. Das Dokument, hauptsächlich verfasst vom späteren Präsidenten Thomas Jefferson, stand am Anfang der modernen westlichen Demokratien.
Bislang wurden diese Schlüsselereignisse, in denen sich vor 250 Jahren welthistorische Tendenzen bündelten, meist unabhängig voneinander betrachtet. So sprach der frühere US-Notenbankpräsident Alan Greenspan in einer Rede von einem bloßen „Zufall“, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus demselben Jahr stammt wie der „Wohlstand der Nationen“.
Mit Blick auf die exakte Jahreszahl mag das stimmen, trotzdem täuscht dieses Urteil über den realhistorischen wie geistesgeschichtlichen Zusammenhang der drei Ereignisse hinweg. „Als Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung das Recht auf ‚Leben, Freiheit und das Streben nach Glück‘ beschwor, führten ihm unsichtbar die schottischen Aufklärer die Feder“, urteilt der österreichische Philosoph und Smith-Biograph Gerhard Streminger. Und Benjamin Franklin, der die Unabhängigkeitserklärung redigierte, war ein persönlicher Freund William Strahans, des Verlegers der beiden Schotten.
Ethik und Markt gehörte für Smith zusammen
Der Text der Kolonisten ruhte zu wesentlichen Teilen auf ähnlichen intellektuellen Fundamenten wie die Schriften der beiden schottischen Denker, und ihre epochemachende Wirkung entfalteten beide im Zusammenwirken mit den technischen Möglichkeiten, die sich aus der neuen Maschinenkraft ergaben. Und schließlich verschränkten sich politische und ökonomische Ideen, geistige und materielle Innovationen auf eine Art und Weise, die sich nur in der Gesamtbetrachtung erschließt – und die höchst aktuell erscheint in einer Zeit, in der Autoritarismus und Protektionismus auf dem Vormarsch sind.
Während der Loslösung der amerikanischen Kolonien spielten ökonomische Fragen eine weit größere Rolle als später oft wahrgenommen. Und Adam Smith war eben kein Professor für Ökonomie, die es als Fach noch gar nicht gab, sondern zunächst Lehrstuhlinhaber für Moralphilosophie. Die viel diskutierte Frage, wie sich seine Ideen über den freien Markt mit seinem Frühwerk über „Die Theorie der ethischen Gefühle“ vereinbaren lassen, stellt sich wohl gar nicht: Für Smith gehörte beides zusammen.
Am Anfang der amerikanischen Unabhängigkeit stand eine Geldfrage. „No taxation without representation“, keine Besteuerung ohne politische Repräsentation: So hatte es der Pfarrer der Old West Church in Boston gepredigt, und so argumentierten auch die Kolonisten, die wenig später in Indianerverkleidung eine größere Teeladung von Bord eines britischen Schiffs ins Hafenbecken warfen. Die rechtspopulistische Tea-Party-Bewegung, die letztlich den heutigen Präsidenten Donald Trump ins Amt brachte, leitete ihren Namen von diesem Ereignis ab.
Ein Aufstand für den freien Handel
Dabei handelte es sich bei der „taxation“, gegen die sich die Proteste im 18. Jahrhundert richteten, genau genommen gar nicht um Steuern, sondern um Zölle: Die Siedler sollten auf den Tee, den die East India Company aus Indien über England heranschaffte, einen – vergleichsweise moderaten – Aufschlag bezahlen. Insofern steht am Beginn der Vereinigten Staaten ein Aufstand für jenen freien Handel, den ihr Präsident heute bekämpft.
Nicht die Amerikaner, sondern die Engländer taten damals, was heute Donald Trump versucht: Sie wollten den Kolonisten die Kosten für deren eigene Verteidigung auferlegen. Schließlich hatte England in der Neuen Welt gerade Krieg gegen jene Franzosen und Native Americans geführt, die den Expansionsdrang der Siedler beschränkten, außerdem garantierte es die Sicherheit auch der nordamerikanischen Handelsschiffe auf den Weltmeeren. Für beides mussten die Kolonien, nachdem sie ihren Zoll-Beitrag verweigert hatten, dann selbst aufkommen.
Die enge Verbindung von ökonomischen Fragen und persönlichen Freiheitsrechten kennzeichnete auch das Denken des Schotten Adam Smith. „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen“, lautet einer der bekanntesten Sätze aus seinem Hauptwerk.
Die Befreiung des Einzelnen aus feudalen Abhängigkeiten
Es geht hier also nicht nur darum, dass aus dem wirtschaftlichen Eigeninteresse der Akteure mehr kollektiver Wohlstand entsteht. Sondern eben auch um die Befreiung des Einzelnen aus feudalen Abhängigkeiten. Denn umgekehrt gilt das auch für den Bäcker und Metzger selbst: Indem er nicht etwa den Hof eines Fürsten beliefert, sondern Hunderte oder gar Tausende von Kunden, muss er sich nicht dem Willen eines Einzelnen unterwerfen, der Kunde ist gerade nicht sein König.
Eher ambivalent erscheinen dem Moralphilosophen dagegen die Folgen der von ihm propagierten Arbeitsteilung, sowohl zwischen den Individuen als auch zwischen den Nationen. Er rühmt die Vorzüge der Spezialisierung, die allen Beteiligten zugutekommen: Der Arbeiter in einer Stecknadelfabrik erzielt ein höheres Einkommen als der selbständige Schmied, der alle Arbeitsschritte mit ineffektiver Kleinarbeit selbst erledigt – und das, obwohl der Eigentümer der Fabrik daran mitverdient, faire Lohnverhandlungen und staatlichen Arbeiterschutz vorausgesetzt.
Zugleich warnte der Autor aber auch davor, dass die repetitive, „geistlose Tätigkeit“ in einem solchen System die Menschen „stumpfsinnig und einfältig“ mache, ein Gedanke, der von der marxschen „Entfremdung“ gar nicht so weit entfernt ist. Um gegenzusteuern, brauche es ein entsprechendes Angebot an öffentlicher Bildung – gewissermaßen ein Programm gegen den Populismus, aus moderner Sicht formuliert.
Smith nahm Ricardo vorweg
Ähnlich verhält es sich für den Schotten im internationalen Maßstab. Lange bevor David Ricardo seine Theorie der komparativen Kostenvorteile entwickelte, nahm er sie teilweise schon vorweg: Es sei zwar möglich, urteilte Smith, in schottischen Gewächshäusern Wein anzubauen, aber eben zu erheblich höheren Kosten als in südlicheren Gefilden (und in minderer Qualität, möchte man hinzufügen). Spezialisierung ist demzufolge angesagt, nötig ist dafür ein freier Handel, der durch Zölle so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Zugleich warnte Smith aber auch hier, dass Märkte nicht schlagartig, sondern nur schrittweise geöffnet werden dürften, damit nicht Populisten von der entstehenden Disruption profitieren.
Erstaunlicherweise formulierte Smith solche Bedenken in seinem Spätwerk über den „Wohlstand der Nationen“, das gemeinhin als Plädoyer für eine grenzenlose Marktfreiheit gilt, deutlicher als in seinem Frühwerk über die „Theorie der ethischen Gefühle“, das als der idealistischere Wurf angesehen wird. Der vermeintliche Widerspruch ist allerdings schnell aufgelöst: In jüngeren Jahren war der Autor davon überzeugt, dass die natürliche Empathie („sympathy“) des Menschen die Dinge schon regeln würde. In fortgeschrittenem Alter schien er sich da nicht mehr so sicher zu sein.
Von den Nützlichkeitserwägungen der älteren schottischen Aufklärer wie David Hume setzte er sich dabei aber deutlich ab: Gerade indem die Menschen nicht immer in einem rationalen Eigeninteresse handeln, fördern sie unter Umständen den allgemeinen Nutzen. Von der „unsichtbaren Hand“ sprach Smith, von den nicht intendierten Folgen des eigenen Handelns würde man heute reden. Dass Menschen oft völlig nutzlose Dinge schätzen, schafft beispielsweise Jobs und trägt zum Wohlstand der Gesellschaft bei, auch können Täuschungen und Illusionen den Fleiß der Menschen fördern. Das Ergebnis sind Verhältnisse, „die besser sind als die Absichten der Menschen“, wie Biograph Streminger formuliert.
Der Kirchenkritiker Smith
Die Überzeugung, dass die vielfältigen Interdependenzen eines global vernetzten Wirtschaftsraums das Wohlergehen der Menschheit fördern, teilte der Moralphilosoph Adam Smith mit dem Althistoriker Edward Gibbon, dessen Werk er bejubelte: „Nach allgemeiner Übereinstimmung aller Männer von Geschmack und Bildung, die ich kenne oder mit denen ich korrespondiere, steht er damit an der Spitze der gesamten literarischen Gemeinschaft, die derzeit in Europa existiert.“
Gemeint war damit allerdings ein Imperium wie das römische, das im Wesentlichen auf dezentralen Strukturen beruhte, und nicht ein Kolonialismus, der durch einseitige Ausbeutung die Entwicklungschancen aller schmälerte. Eine Institution wie die Römische Kirche, für Smith der „fürchterlichste Zusammenschluss gegen Freiheit, Vernunft und Glück der Menschen“, konnte nach Ansicht beider nur hinderlich sein. Dem Aberglauben galt es mit wissenschaftlichen Fakten entgegenzutreten, was nicht ausschloss, dass die schottischen Aufklärer an einen Gott im abstrakteren Sinn glaubten.
Erstaunlich weitsichtig blickte Adam Smith auf die entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika, denn er voraussagte, sie würden „zu einem der größten und mächtigsten Länder werden, die es jemals auf Erden gegeben hat“. Er sah voraus, dass sich der Schwerpunkt der angelsächsischen Welt auf die andere Seite des Atlantiks verlagern werde, und seinen Landsleuten auf den Britischen Inseln empfahl er, sich dieser Entwicklung nicht mit schädlichen Handelsbarrieren entgegenzustellen.
All diese aufklärerischen Gedanken fanden ihren Eingang in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die der Französischen Revolution um 13 Jahre vorausging, an deren Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte Jefferson als Botschafter in Paris mitwirkte. Schon der erste Satz zeugte von einiger Chuzpe. „Wir halten diese Wahrheiten für offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“: Im Kontext der Zeit war das nun gerade nicht offensichtlich, stachen doch auf den ersten Blick zunächst die Unterschiede zwischen den Menschen ins Auge.
Erfüllt haben sich all diese Hoffnungen bis heute nur zum Teil. Die Erfindung von James Watt befreite die Menschheit nicht von der Arbeit, und anders als von Adam Smith erwartet, führten internationale Kooperation und gegenseitige Abhängigkeit nicht zu einem ewigen Frieden. Umso mehr lohnt die Lektüre dieser klassischen Texte, die sich durchaus als Warnung vor aufkeimenden Populismen lesen lassen.
