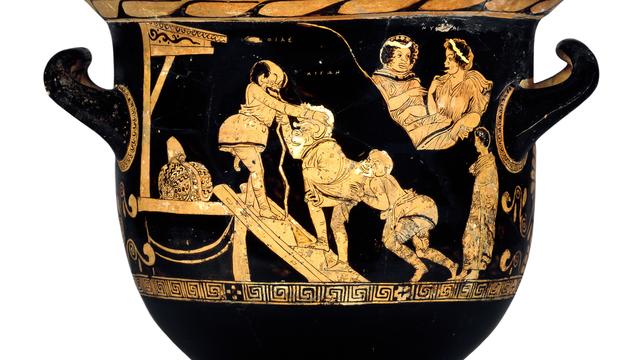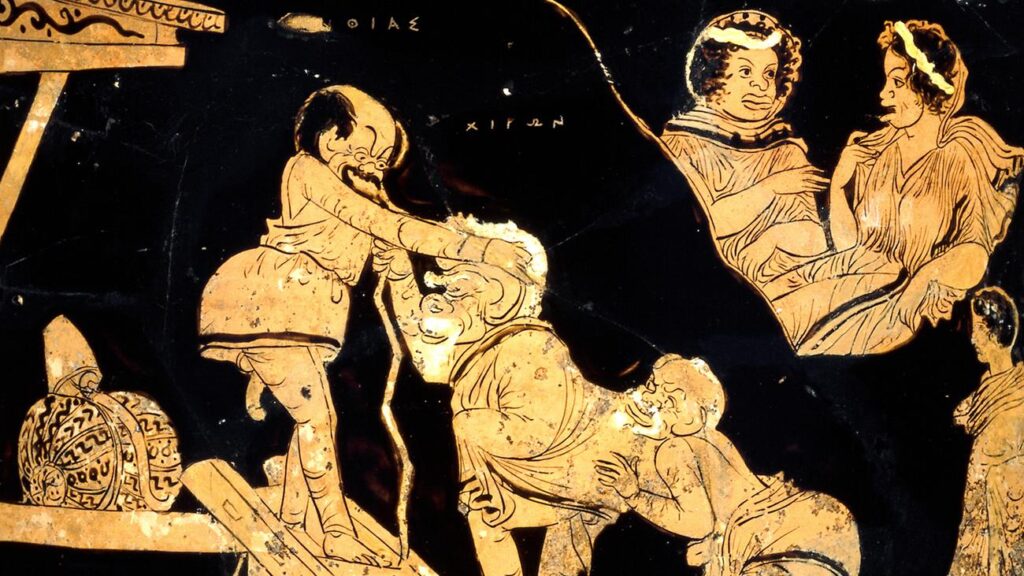
Selbstverständlich darf ein Mensch einen anderen nicht versklaven. Sklaverei ist nicht nur ungerecht, sie ist widerwärtig, ja „abgeschmackt“, so rümpfte Karl Marx einmal die Nase. Und er konnte tatsächlich miterleben, wie seine Empörung allgemeines Gesetz wurde, wie im 19. Jahrhundert erst die britischen Kolonien, dann die Vereinigten Staaten die Sklaverei abschafften. Ein Paradebeispiel moralischen Fortschritts!
Doch was genau macht es dazu? Die Antwort könnte so einfach sein: Gäbe es eine absolute, universell gültige Idee des Guten – sich darauf zuzubewegen wäre Fortschritt, Abkehr wäre Rückschritt. In den letzten 50 Jahren verlor die analytische Philosophie den Glauben an diese schöne Vorstellung. Man erkannte: Was gut ist, verändert sich. Moral ist zeit- und ortsabhängig. Dürfen wir Veränderungen dann überhaupt noch fort- oder rückschrittlich nennen? Oder rattert einfach ein Ereignis nach dem anderen an uns vorbei, wie in einem dieser Filme, die keine Geschichte mehr erzählen, keinen Sinn mehr ergeben, die in Ausstellungen zeitgenössischer Kunst laufen und die man manchmal zweimal schaut, ohne es zu merken? In einem dünnen Bändchen, das in die Manteltasche jedes Desillusionierten passt, möchte jedenfalls Thomas Nagel die Rede vom Fortschritt retten. Dabei kommt Nagel selbst aus einer vergangenen Zeit, als Philosophinnen und Philosophen die großen Fragen schnurgerade angingen, statt sich in Fußnotenapparaten zu verheddern. Der 87-Jährige war Professor an der New York University und ist berühmt für einen Aufsatz über die Frage, wie es ist, eine Fledermaus zu sein (möglicherweise anders als Menschsein oder auch nicht – wir werden es nie erfahren). Wer nur einen Nachmittag Zeit hat, um denken zu lernen, der sollte Nagel lesen, den Universalphilosophen: Bei den Fledermäusen ging es um die Philosophie des Geistes, lange arbeitete er sich an den Naturwissenschaften und deren Objektivitätsbegriff ab, als Schüler von John Rawls schärfte er dessen Gleichheitsbegriff. Jetzt widmet er sich der Moral und dem Fortschritt.