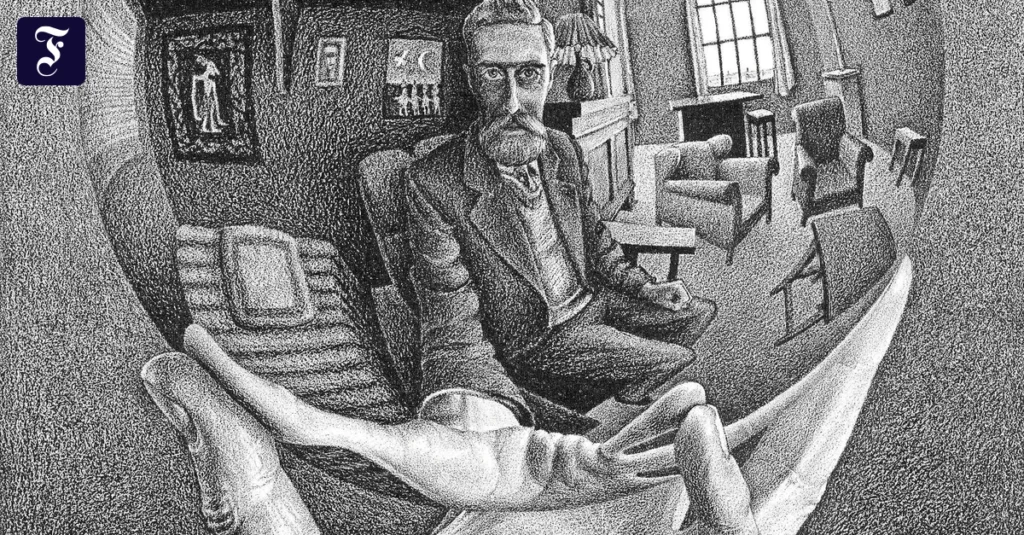
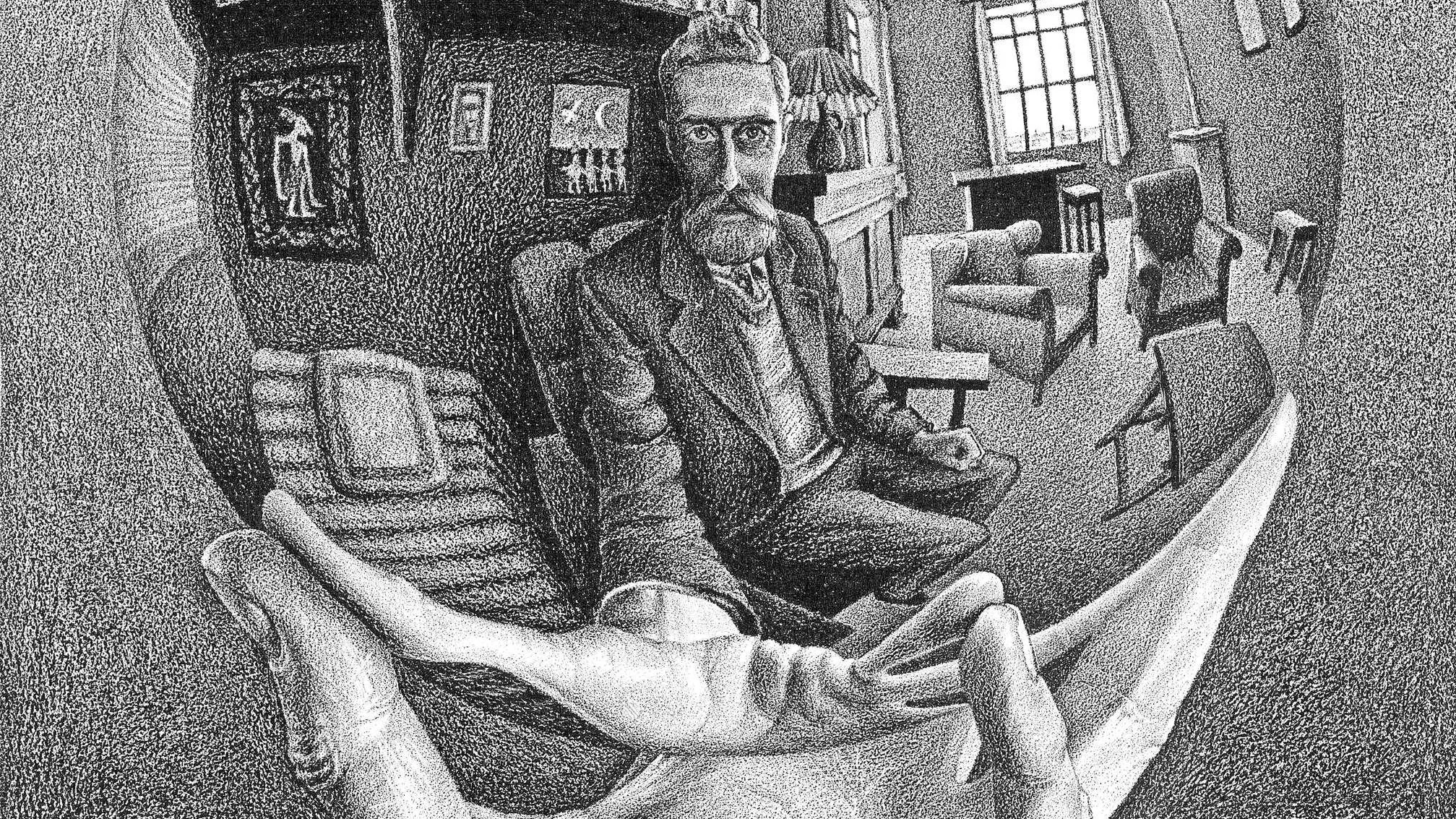
Fragen von Geist und Bewusstsein zählen zu den ältesten Problemen, mit denen sich die Menschheit beschäftigt hat, und zwar in praktisch allen Kulturen. Geist und Bewusstsein sind nicht nur zentral für unser Selbstverständnis, Fortschritte im Verständnis dieser Fähigkeiten hätten auch praktische Relevanz, etwa für die Behandlung dementer Patienten; und man kann vermuten, dass sie auch für die Auseinandersetzung um Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen werden.
Die Wissenschaften haben sich bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dieses Themas angenommen. In den vergangenen Jahrzehnten ist allerdings noch einmal ein bemerkenswerter Aufschwung zu beobachten. Große Forschungsprogramme wurden aufgelegt, die Zahl der Veröffentlichungen hat sich vervielfacht. Das Interesse an Problemen des Bewusstseins und der Aufwand, der zu ihrer Erforschung getrieben wird, sind außerordentlich hoch. Bei den Ergebnissen sieht es leider anders aus. Trotz wichtiger Fortschritte in vielen einzelnen Bereichen von Neurowissenschaften und Psychologie ist der Wissensgewinn in Bezug auf Geist und Bewusstsein nach wie vor überschaubar. Normalerweise konzentrieren sich wissenschaftliche Diskussionen im fortgeschrittenen Stadium auf eine kleine Zahl von Streitfragen, die zwischen wenigen konkurrierenden Theorien ausgefochten werden. So stritten sich in der Geologie einst Neptunisten und Plutonisten, ob Gesteine aus Sedimenten der Meere oder aus vulkanischer Aktivität stammen. Bei der Entschlüsselung der chemischen Grundlagen von Wasser standen die Phlogistontheoretiker, die Wasser als ein Element verstanden, den Vertretern der Analytischen Chemie gegenüber, die Wasser als eine Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff betrachteten.
Im Widerspruch zu den empirischen Daten
In der Auseinandersetzung um Bewusstsein sieht es völlig anders aus: Wie Robert Lawrence Kuhn kürzlich gezeigt hat, gibt es nicht zwei, nicht zwanzig, sondern mehr als zweihundert konkurrierende Theorien des Bewusstseins. Bei den empirischen Studien ist die Situation ähnlich unübersichtlich, auch hier zeichnet sich keine Tendenz zugunsten einer bestimmten Theorie ab. Wie eine Gruppe Wissenschaftler um Itay Yaron in Auswertung der neueren Literatur gezeigt hat, achten die vielen Arbeitsgruppen offenbar darauf, mit ihren experimentellen Daten die jeweils eigene Theorie zu stützen. Deshalb werden nicht nur die verwendeten Methoden passend zum eigenen Ansatz gewählt, sondern auch die Daten im Nachhinein so interpretiert, dass sie der hausgemachten Wahrheit entsprechen.
Nur recht selten sind dagegen theoretisch begründete, neutrale Studien gemacht worden, in denen mit halbwegs objektiven Verfahren zwei Theorien gegeneinander getestet werden. Eine sehr große und sorgfältig vorbereitete, 2025 in „Nature“ erschienene Studie von Oscar Ferrante und einigen Kollegen, die nach diesem Muster vorging, hat gezeigt, dass zwei der heute besonders häufig zitierten Theorien, die Global Workspace Theory und die Integrated Information Theory, in zentralen Fragen im Widerspruch zu den empirischen Daten stehen. Auch sonst sind diese Theorien heftig umstritten: Während die Integrated Information Theory von namhaften Wissenschaftlern in einem offenen Brief als „nicht testbare Pseudowissenschaft“ abgetan wurde, sieht die Global Workspace Theory ihre gesamte empirische Grundlage infrage gestellt: Kritiker behaupten, dass die zentralen Belege der Theorie auf Effekten basieren, die auf methodische Fehler zurückzuführen sind.
Wie lässt sich Bewusstsein definieren?
Doch die Probleme in der heutigen Bewusstseinsforschung ergeben sich nicht nur aus einem Mangel an verlässlichen empirischen Daten. Unklar ist auch, welches Phänomen erklärt werden soll – und was eigentlich das Problem ist, um dessen Lösung es geht. Natürlich haben wir eine intuitive Vorstellung von Bewusstsein: Wir wissen, was es heißt, eine Rotempfindung zu haben oder einen frisch gebrühten Kaffee zu riechen. Die Schwierigkeit besteht aber darin, diese subjektiven Erfahrungen in eine objektive Beschreibung zu übersetzen.
Deutlich erkennbar ist diese Unklarheit in einem berühmten Aufsatz des Philosophen Thomas Nagel mit dem Titel „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ Der Aufsatz hatte großen Anteil daran, dass Bewusstsein in den Siebzigerjahren wieder zu einem wichtigen philosophischen Thema wurde. Doch Nagels Beschreibung von Bewusstsein als der „Art, wie es ist“, ein Mensch zu sein, ist merkwürdig nebulös: Welche Kriterien liefert die Formel, um bewusste von unbewussten Geisteszuständen zu unterscheiden? Man kann Nagel zugutehalten, dass er nur auf eine Leerstelle in den zeitgenössischen Theorien aufmerksam machen wollte. Doch warum ist diese Leerstelle fünfzig Jahre später immer noch nicht durch ein greifbares Konzept subjektiver Erfahrung gefüllt?
In der Sackgasse der Zirkelschlüsse
Tatsächlich gibt es einige tieferliegende Gründe, die zumindest teilweise erklären, warum wir immer noch keine klare Vorstellung von Bewusstsein, geschweige denn einen halbwegs brauchbaren Begriff entwickelt haben. Zunächst ist Bewusstsein schlicht schwer zu definieren. Üblicherweise ordnen wir in einer Definition das Phänomen einer übergeordneten Kategorie zu und nennen dann Unterscheidungsmerkmale zu anderen Elementen dieser Kategorie. So zählen wir etwa Junggesellen zur Kategorie der Männer und unterscheiden sie von anderen Männern dadurch, dass sie unverheiratet sind.
Beim Bewusstsein versagt diese Methode jedoch gleich aus zwei Gründen: Es fällt schwer, eine übergeordnete Kategorie für Bewusstsein zu finden. Bewusstsein scheint etwas Einzigartiges zu sein, das aus allen anderen Kategorien herausfällt. Das einzige, was wir über Bewusstsein sagen können, ist, dass es bewusst ist. Doch damit würde die Definition zirkulär. Doch selbst wenn man Bewusstsein etwa zur Kategorie der psychischen Phänomene zählen wollte, stellt sich die Frage nach dem Unterscheidungsmerkmal zu anderen psychischen Phänomenen. Der Unterschied scheint einfach darin zu bestehen, dass die einen Zustände bewusst sind und die anderen nicht. Allerdings würde man damit Bewusstsein durch Bewusstsein definieren, die Definition wäre abermals zirkulär und damit nichtssagend.
Entwicklungsgeschichtlich relativ früh entstanden
Ähnliche Probleme treten schon bei einer bloßen Beschreibung des Phänomens auf. Gerade weil sämtliche Erfahrungen Bewusstsein ausmachen, fällt es uns schwer, ein besonders charakteristisches Merkmal anzugeben. Bewusst können Schmerzen und Lust sein, Hass und Liebe, Gedanken und Gefühle. Das Bewusstsein ändert nichts am Charakter dieser Zustände. Aus dem gleichen Grund fällt es schwer, die Auswirkungen von Bewusstsein auf unser Verhalten zu charakterisieren: Wir verhalten uns ganz unterschiedlich, je nachdem, ob wir Schmerzen spüren oder Lust, Hass oder Liebe. Und dass wir bei alldem bewusst sind, kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass wir von der „Erfahrung“ dieser Zustände sprechen – wozu also braucht man dann noch den Verweis auf Bewusstsein?
Wenn es so schwierig ist, das Phänomen des Bewusstseins zu fassen – können wir zunächst nicht bei einem besser greifbaren Phänomen ansetzen? Im Folgenden möchte ich eine solche Alternative vorschlagen. Wir können die gerade skizzierten Schwierigkeiten nämlich vermeiden, wenn wir uns erst einmal mit dem konkreteren Beispiel subjektiver Erfahrung befassen, etwa mit Schmerzempfindungen, genauer noch: mit affektiven Schmerzempfindungen.
Im Alltag betrachten wir Schmerzen normalerweise als einheitliches Phänomen. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass Schmerzempfindungen auf zwei unterschiedliche neuronale Systeme zurückgehen, die sich in ihrer Funktion und ihrem Beitrag zur subjektiven Erfahrung klar voneinander unterscheiden. Eines dieser Systeme ist das affektive Schmerzsystem, das für den unangenehmen Charakter von Schmerzerfahrungen verantwortlich ist und gleichzeitig dafür sorgt, dass wir Schmerzen vermeiden. Auf der neuronalen Ebene liegen ihm Aktivitäten im vorderen Teil der Hirnrinde – in der Nähe der Stirn – zugrunde. Das affektive Schmerzsystem ist wohl entwicklungsgeschichtlich relativ früh entstanden. Später kam dann das zweite, das sensorische Schmerzsystem hinzu. Es lässt uns den Ort und die Art einer Verletzung empfinden und basiert auf Aktivitäten in der somatosensorischen Hirnrinde und der Insula, also in den mittleren Arealen der Hirnrinde oberhalb der Ohren.
Das Schmerzsystem verbindet Wahrnehmung und Handeln
Wichtig ist, erstens, dass sich das Phänomen der affektiven Schmerzen gut beschreiben lässt, zumal hier auch das übliche Definitionsverfahren funktioniert. Affektive Schmerzen sind eben nicht einfach nur irgendeine „Art, wie es ist“, vielmehr gehören sie zu einer ganz bestimmten Kategorie, nämlich der der besonders unangenehmen Erfahrungen. Von anderen unangenehmen Erfahrungen, etwa von Furcht- oder Ekelempfindungen, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie von Beeinträchtigungen unseres Körpers ausgelöst werden und darauf abzielen, solche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Dies zeigt, zweitens, dass wir bei Schmerzen die Verbindung zwischen der subjektiven Ebene (unangenehmes Gefühl) und der objektiven Ebene (Versuch der Vermeidung) vergleichsweise einfach herstellen können. Damit besitzen wir, drittens, auch objektive Merkmale, die uns dabei helfen können, die neuronalen Mechanismen zu identifizieren, die der Schmerzempfindung zugrunde liegen. Es scheint also, als könnten wir mit der Fokussierung auf Schmerzen einige der Probleme vermeiden, die die Unbestimmtheit des Bewusstseinsbegriffs mit sich bringt.
Tatsächlich gibt es bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sich mit den neuronalen Grundlagen von affektiven Schmerzen befassen. Da wir vergleichsweise konkrete Vorstellungen von diesen Schmerzen haben, ist die empirische Überprüfung eher unproblematisch; der wissenschaftliche Konsens entsprechend groß. Dabei ist von Vorteil, dass Untersuchungen gut an einer neurologischen Störung ansetzen können, der Schmerzasymbolie, die zum Ausfall des affektiven Schmerzsystems führt. Wenn die obigen Annahmen zutreffen, dann sollten Schmerzen für Patienten, bei denen nur noch das zweite, sensorische Schmerzsystem aktiv ist, nicht unangenehm sein, zudem sollten die Patienten nicht versuchen, Schmerzen zu vermeiden. Tatsächlich konnten empirische Studien diese Annahmen bestätigen: Den Patienten waren auch starke Schmerzen nicht unangenehm, einige lachten sogar während der Experimente. Und wie erwartet, zeigten die Patienten auch bei starken Schmerzen keinerlei Vermeidungsverhalten, in einigen Fällen suchten sie die Schmerzreize geradezu. Doch auch damit bleibt immer noch die Frage offen, warum wir Schmerzen bewusst erleben.
Auf der Suche nach Überschneidungen
Vertreter der oben bereits genannten Global Workspace Theorie glauben, dass der präfrontale Kortex hierbei eine wichtige Rolle spielt, indem er Informationen über weitreichende neuronale Netze im gesamten Gehirn verbreitet. Die Antwort ist allerdings unbefriedigend, denn sie erklärt etwa nicht, warum dieser Informationsaustausch nicht genauso gut unbewusst verlaufen kann. Mittlerweile gibt es erste Hinweise, dass die Schmerzforschung hier einen Beitrag leisten könnte. Ein Grund dafür, dass die Schmerzerfahrung bewusst sein muss, könnte sein, dass Bewusstsein ein gemeinsames Format schafft, um die neuen Informationen über den Ort einer Schmerzerfahrung und mögliche Vermeidungsstrategien miteinander zu verbinden.
Wiederum bietet sich ein Paradigma aus der Schmerzforschung zur Überprüfung an: die konditionierte Ortsaversion. Sie äußert sich so, dass Menschen und Tiere Orte vermeiden, an denen sie affektive Schmerzen bewusst erfahren haben. Der Prozess ist nicht nur vergleichsweise einfach und gut verstanden, vielmehr ist es bereits gelungen, den Lernprozess zu stoppen, indem man die Neurone „abschaltet“, die für die affektive Schmerzerfahrung relevant sind. Würde es gelingen, den konkreten Beitrag zu bestimmen, den die Aktivität dieser Neuronen und damit die der bewussten Schmerzerfahrung zu diesem Lernprozess leisten, würden wir besser verstehen, warum bewusster Schmerz so wichtig für den Lernprozess ist. Ob der Versuch letztlich erfolgreich sein wird, kann man heute nicht sagen. Immerhin zeigen diese Überlegungen aber, dass wir es nicht mit einem mysteriösen Rätsel zu tun haben, sondern mit einem wissenschaftlichen Problem, das zumindest im Prinzip lösbar sein sollte.
Doch nehmen wir einmal an, dieses Problem wäre gelöst und wir würden die neuronalen Mechanismen kennen, die der bewussten Erfahrung von Schmerzen zugrunde liegen; zudem hätten wir verstanden, warum die Schmerzerfahrung bewusst sein muss, um Lernprozesse zu ermöglichen. Selbst dann hätten wir immer noch keine Lösung des eingangs genannten allgemeinen Problems des Bewusstseins, ja wir wüssten immer noch nicht, ob es „das“ Problem des Bewusstseins überhaupt gibt. Wir wüssten lediglich, wie die Natur das Problem im Falle von bewussten Schmerzen gelöst hat. Hätten wir ähnliche Lösungen auch für andere Formen bewusster Erfahrung, für positive Emotionen vielleicht, aber auch für Hungerempfindungen, Geruchswahrnehmungen, und irgendwann auch für bewusste Gedanken, dann könnten wir sehen, ob es hier wichtige Überschneidungen gibt.
Bald könnten die gängigen Theorien hinfällig sein
Prinzipiell erscheinen dabei zwei unterschiedliche Szenarien denkbar. In einem Fall würde sich herausstellen, dass die einzelnen Formen der bewussten Erfahrung substanzielle Gemeinsamkeiten haben. Sie könnten zum Beispiel eine gemeinsame Infrastruktur besitzen, so wie es etwa die Global Workspace Theory annimmt. Die Theorie geht davon aus, dass es eine Art gemeinsamer „Bühne“ im präfrontalen Kortex gibt, die dafür sorgt, dass bewusste Informationen allen relevanten Verarbeitungszentren des Gehirns zugänglich gemacht werden. Der Theorie zufolge ermöglicht Bewusstsein damit, dass Lernprozesse auf Informationen zurückgreifen können, die sonst nur isoliert voneinander in den einzelnen Verarbeitungszentren schlummern würden. Dieses Modell erscheint plausibel, aber wie schon erwähnt haben neuere Experimente Zweifel daran geweckt.
Das wirft die Frage nach einer Alternative auf. Es könnte sich auch herausstellen, dass es – anders als von der Global Workspace Theory angenommen – keine „Verarbeitungszentrale“ im Gehirn gibt. Die einzelnen Netzwerke für Schmerzen, Wahrnehmungen, Emotionen etc. würden dann selbständig bewusste Erfahrungen hervorbringen, Informationen austauschen und ihre Aktivitäten miteinander koordinieren. Welche Variante zutrifft, ist eine rein empirische Frage, und natürlich könnte es alle möglichen Zwischenstufen geben sowie Varianten, die wir heute überhaupt noch nicht im Blick haben.
Ein Problem ist, dass die heute gängigen Untersuchungsverfahren immer nur bestimmte Aspekte von neuronaler Aktivität messen können. Das am häufigsten verwendete Verfahren misst etwa deren räumliche Verteilung. Es liegt daher auch für die heutigen Theorien des Bewusstseins nahe, sich auf die räumliche Verteilung neuronaler Aktivität zu stützen – ähnlich wie es schon die Phrenologen des neunzehnten Jahrhunderts getan hatten. Aber vielleicht ist es gar nicht entscheidend, welche Teile des Gehirns aktiv sind, vielleicht kommt es auf bislang unbekannte Merkmale neuronaler Aktivität an, die wir noch nicht messen können, weil die Messmethoden fehlen? Am Ende könnte dies auch erklären, dass die empirischen Resultate noch keine klare Tendenz erkennen lassen. Wir sollten also noch auf einige Überraschungen gefasst sein, und diese Überraschungen dürften nicht nur die Messdaten betreffen, sondern auch das Bild, das wir uns von dem zu lösenden Problem machen. Es kann sein, dass unsere gegenwärtigen Theorien des Geistes sich in hundert Jahren in irgendeiner Rumpelkammer der Wissenschaftsgeschichte wiederfinden – zusammen mit den Theorien vom Wärmestoff, dem Phlogiston und dem lichtleitenden Äther.
