
Der erste preußische König hat keine gute Presse in Deutschland. Jener Fürst, der sich am 18. Januar 1701 in Königsberg selbst die Krone aufsetzte, durch die er von Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, zu Friedrich I., „König in Preußen“ wurde, gilt der Geschichtswissenschaft als eitel, ehrsüchtig, leicht beeinflussbar und verschwenderisch bis hin zum Staatsbankrott. Unter ihm „sank die preußische Politik zur Intrigue hinab“, schrieb Johann Gustav Droysen 1865, und Generationen deutscher Historiker sind ihm in dieser Einschätzung gefolgt.
Dabei übernahmen sie oftmals unkritisch das Verdikt, das Friedrichs gleichnamiger Enkel ein gutes Jahrhundert vor Droysen in seiner „Geschichte des Hauses Brandenburg“ formuliert hatte. Er sei „groß im Kleinen und klein im Großen“ gewesen, fasste Friedrich „der Große“ seine Verdammung des Vorfahren zusammen, dessen „asiatischer Prunk“ und prasserisches „Zeremonienwesen“ seine Länder an den Rand des Ruins gebracht habe. Es dauerte lange, bis sich Gegenstimmen erhoben, und oft kamen sie nicht aus dem Zentrum, sondern von den Rändern der deutschen Historiographie.

Diesen Zustand rückwirkender Verdunkelung möchte Peter Stephan mit seinem Buch über „Die Erfindung Preußens“ beenden. Der Potsdamer Kunsthistoriker dreht das Urteil des Enkels über den Großvater geradezu um: nicht der erste, sondern der zweite Friedrich sei „kleinlich“ gewesen, wenigstens, was seine Potsdamer Stadt- und Schlösserarchitektur betreffe, während unter dem Begründer der Monarchie der preußische Staat ebenso wie die Hauptstadt Berlin in barocken Formen aufgeblüht seien. Den realpolitischen Sinn dieser Prachtentfaltung stellt für Stephan die Erlangung der Königswürde dar. Die neue Krone sei nicht nur das „grand dessin“, das eigentliche Lebensziel des Kurfürsten gewesen, der wegen seiner durch einen frühkindlichen Sturz und eine Skoliose verkrüppelten Gestalt als „petite majesté“ verspottet wurde – sie habe auch, kraft ihrer symbolischen Wirkung, den Grundstein für Preußens Vormachtstellung in Mitteleuropa und damit für die deutsche Reichseinigung gelegt.
In einer Reihe mit Bernini und Donatello
Das thematische Feld, in dem der Autor seine Beweisführung plaziert, ist interessanterweise nicht die Kriegs-, sondern – passend zu seiner Lehrtätigkeit – die Kunstgeschichte. Bei Friedrichs Regierungsantritt 1688 war Brandenburg mit seinen weit verstreuten Territorien eine zwar militärisch bedeutende, aber diplomatisch zweitrangige Regionalmacht. Um in die erste Liga der europäischen Potentaten aufzusteigen, musste der hohenzollersche Kurfürst für sich eine Krone „erfinden“, die – anders als die polnische für seinen Rivalen August von Sachsen oder die englische für die Welfen in Hannover – nicht schon für ihn bereitlag. Dieses erfundene Königtum wiederum erheischte, um vor der europäischen Öffentlichkeit seine Geburt zu legitimieren, ein ästhetisches, architektonisches und rhetorisches Gepränge, das Friedrich mit allen Mitteln barocken Mäzenatentums in Werk setzte.
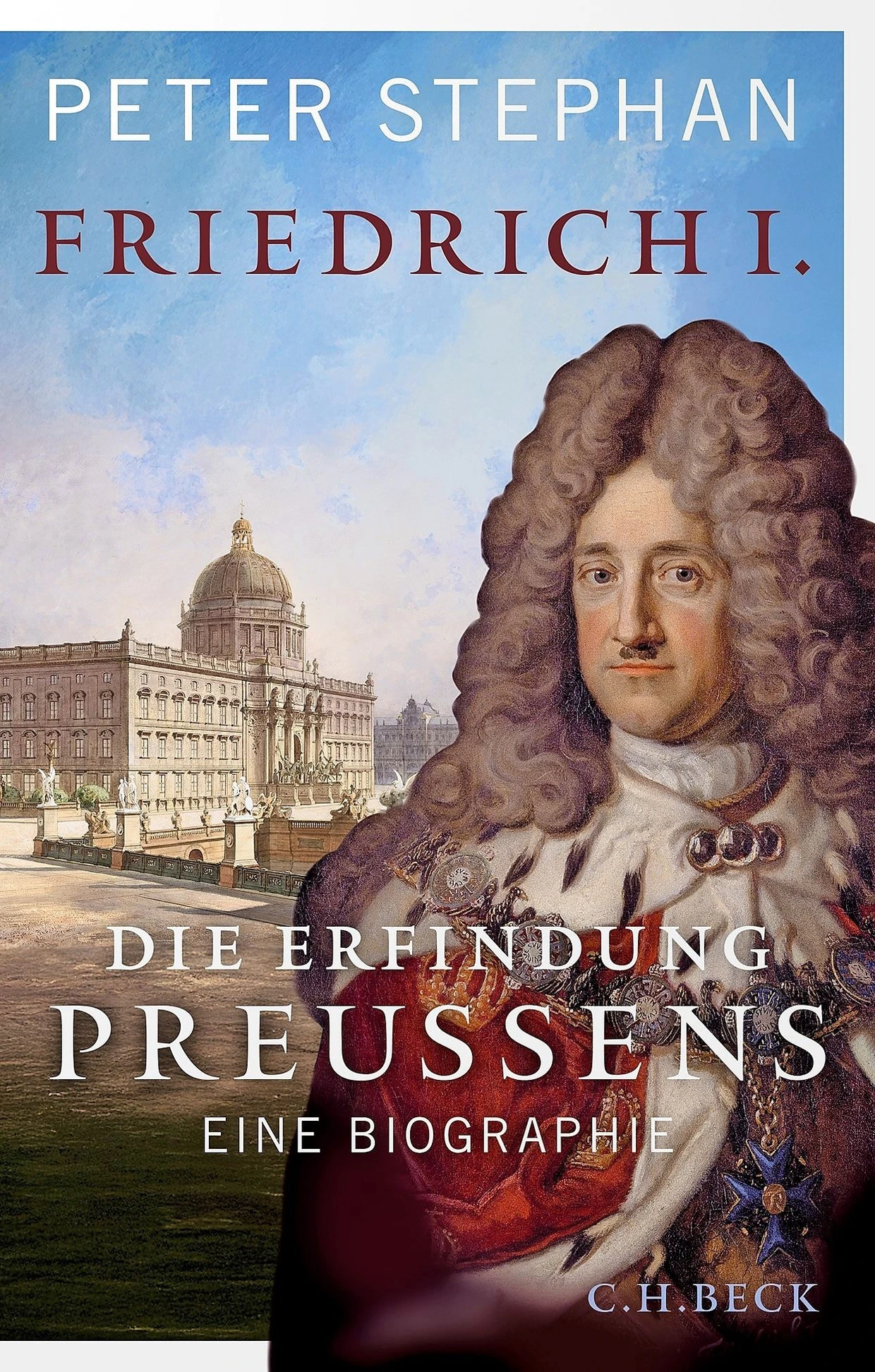
Schon 1697, vier Jahre vor seiner Krönung, hatte der Kurfürst bei seinem Hofbildhauer Andreas Schlüter eine Bronzestatue von sich selbst in Imperatorenpose in Auftrag gegeben. Ein Jahr später berief er Schlüter zum Bauleiter des Zeughauses und wenig später auch des Berliner Schlosses, das aus einem mittelalterlichen Trutzbau mit Renaissance-Anbauten zu einer Residenz nach französischem Vorbild erweitert werden sollte. Zur gleichen Zeit arbeitete Schlüter an einem Reiterdenkmal von Friedrichs Vater, dem „Großen Kurfürsten“ Friedrich Wilhelm I., das ihn nach der Einweihung im Jahr 1703 in ganz Europa berühmt machte und in eine Reihe mit Bernini und Donatello rückte.
Peter Stephan, der über Tiepolos Fresken für die Würzburger Residenz und das Obere Belvedere des Prinzen Eugen in Wien publiziert hat, ist Experte für barocke Bildrhetorik. Folgerichtig verwendet er beinahe die Hälfte seines Buchs dazu, Schlüters Kunst und die seiner Nachfolger zu entziffern. Dabei vermischt sich die Lektüre der allegorischen Gemälde und Skulpturen, die den Preußenkönig und seinen Vorgänger verherrlichen, mit dem Porträt Friedrichs selbst. Die Reiterstatue des „Großen Kurfürsten“ wird zur Ikone der Geschichtspolitik seines Sohnes (und sein Sockelschmuck aus vier Männerfiguren zum Inbild der gebändigten Affekte).
Eine der unruhigsten Epochen der europäischen Geschichte
Die Köpfe der „Sterbenden Krieger“ im Innenhof des Zeughauses stehen für die Humanität des königlichen Auftraggebers. Und das Bildprogramm des Schlosses verkündet mit seinen Gigantenstürzen, den Triumphen Jupiters und Minervas und der Glorifizierung des preußischen Adlers den Beginn eines neuen Friedenszeitalters im Zeichen Friedrichs. Als Anti-Louvre legt sich die neue Residenz nicht nur symbolisch, sondern auch in der Qualität der Ausstattung unübersehbar mit der Hofhaltung des „Sonnenkönigs“ in Paris an.
Das alles liest man mit anhaltender Faszination, zumal der Autor nicht nur die naheliegenden stilistischen Vorbilder, sondern auch überraschende Assoziationen wie Gemälde von Raffael oder zeitgenössische Stiche parat hat. Dennoch fehlt seiner sorgfältigen ikonographischen Deutung eine wichtige, nämlich die historische Dimension. Die Regierungszeit Friedrichs I. fiel in eine der unruhigsten Epochen der europäischen Geschichte. Kurz nach Amtsantritt deckte er mit seinen Truppen die Überfahrt Wilhelms von Oranien nach England, die zur „Glorious Revolution“ und zum Sturz des Hauses Stuart führte. Anschließend beteiligte sich Preußen neun Jahre lang an den blutigen Schlachten des Pfälzischen Erbfolgekriegs, ohne im Frieden von Rijswijk dafür belohnt zu werden.
Friedrichs Sehnsucht nach dem Königtum war die direkte Folge dieser Demütigung, die zugleich den Sturz seines Mentors Eberhard von Dankelman und den Aufstieg der Hofkamarilla um Johann von Wartenberg beschleunigte. Dieser betrieb eifrig den Krönungsplan, doch es bedurfte eines weiteren europäischen Konflikts, um ihn durchzusetzen. Gegen die Zusage, den Kaiser in Wien im Spanischen Erbfolgekrieg mit preußischen Kontingenten zu unterstützen, durfte sich Friedrich in Königsberg selbst die Krone aufsetzen.
Aber schon im Vorjahr seines Triumphs war ein weiterer Krieg im Ostseeraum ausgebrochen, in dem sich Schweden mit seinen Verbündeten auf der einen und Russland, Polen, Sachsen und Dänemark auf der anderen Seite gegenüberstanden. In den Folgejahren drohte sich dieser Konflikt mit den Kämpfen in Spanien und Flandern zu verquicken, was Preußen, dessen Territorien zwischen den Fronten lagen, verzweifelt zu verhindern versuchte. Es kam zu jenem Hin und Her von „Krieg ohne Politik“ und „Politik ohne Armee“, das Droysen in seinem Standardwerk verspottete.
Kein Porträt, aber eine anregende kunsthistorische Skizze
All dies spielt in die Friedens-Metaphorik der Gemälde und Statuen des Berliner Schlosses mit hinein, so wie der Unwille vieler gekrönter Häupter in Europa, Friedrichs Königtum anzuerkennen, den Berliner Hof zu immer neuen Orgien der Prachtentfaltung trieb. Bei Peter Stephan aber bildet dieser historische Hintergrund nur die Begleitmusik zu den ausufernden Rezitativen der Bildbetrachtung. Das hebt seine Biographie aus der Konfektionsware preußischer Königsviten heraus, schwächt sie aber zugleich an einem entscheidenden Punkt. Denn ein Porträt Friedrichs I. entsteht auf diese Weise nicht, nur eine anregende kunsthistorische Skizze.
Peter Stephan: „Friedrich I.“ Die Erfindung Preußens. Eine Biographie. C.H. Beck Verlag, München 2025. 393 S., Abb., geb., 34,– €.
