
Bei Schriftstellern, die es wert sind, lohnt es sich, nach dem kleinen Antriebsmotor im Inneren ihrer Bücher zu forschen. Ian McEwan, der jetzt mit 77 Jahren seinen achtzehnten Roman veröffentlicht, ist es ohne jeden Zweifel wert. „Was wir wissen können“ heißt das Buch, das zeitgleich in England und Deutschland erschienen ist, und die ersten Zeilen dieser Rezension sollen in größtmöglicher Einfachheit von ebenjenem kleinen Motor handeln, der die fast 500 Romanseiten mit Energie versorgt. Es ist ein sogenannter Sonettenkranz – fünfzehn Gedichte, zusammen 210 Zeilen –, den der berühmte Poet Francis Blundy seiner Frau Vivien bei einem denkwürdigen Abendessen zu acht erst vorliest, dann als Geschenk überreicht – handgeschrieben auf Tierhaut, auswendig vorgetragen mit größtem Sinn für die eigene Bedeutung –, anschließend wieder zusammenrollt und auf den Kaminsims legt.
Im Lauf des Buches werden wir erfahren, wovon die fünfzehn Sonette handeln und was der Dichter mit ihnen ausdrücken will, doch wir hören von ihnen nur ein paar Worte Originalzitat. McEwan ist großartig darin, über Lyrik zu schreiben, ohne lyrisch zu werden. Ein weiteres Blundy-Gedicht hat im Buch eine gewisse Bedeutung, „Im Sattel“, und auch hier paraphrasiert der Autor es nur, deutet dichterische Möglichkeiten an, sodass man sich wünscht, jemand wäre hingegangen und hätte es geschrieben. Aber das Wichtige für den Erzählmotor dieses Romans ist, dass Blundys Sonettenkranz, in welchem die Natur eine hervorgehobene Rolle spielt, verschwunden ist und niemand ihn seit jenem Abendessen mehr zu Gesicht bekommen hat. Ebenso bedeutsam: dass sich der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe darüber den Kopf zerbricht. Hundert Jahre später.
Großbritannien ist nur noch ein Archipel
Und damit geht es für Metcalfe (und in gewissem Sinn auch für seine Kollegin und Lebensgefährtin Rose) einerseits um verständlichen akademischen Ehrgeiz und eine detektivische Suche nach einem verschwundenen Text, andererseits um kapitale Fragen, die schlechte oder mittelmäßige Romanautoren erdrückt hätten: was die Gegenwart von einer weiter entfernten Vergangenheit wissen und verstehen kann. Welcher Sinn in den Geisteswissenschaften liegt, die ältere Epochen erforschen. Wie sich überhaupt eine Generation angesichts der Unvorhersehbarkeit der Zukunft aufschwingen kann, ihre eigenen Denkmuster und zeittypischen Beschränktheiten nach vorn fortzuschreiben, als müsste die Welt so werden, wie die Heutigen sie prognostizieren. „Was wir wissen können“ ist ein Roman, der sich selbst trotz der Schwere des ökologischen Zukunftsthemas nicht allzu ernst nimmt und sehr britisch für Skepsis und Gelassenheit plädiert. Bernhard Robben hat ihn in geschmeidiges, elegantes Deutsch gebracht.
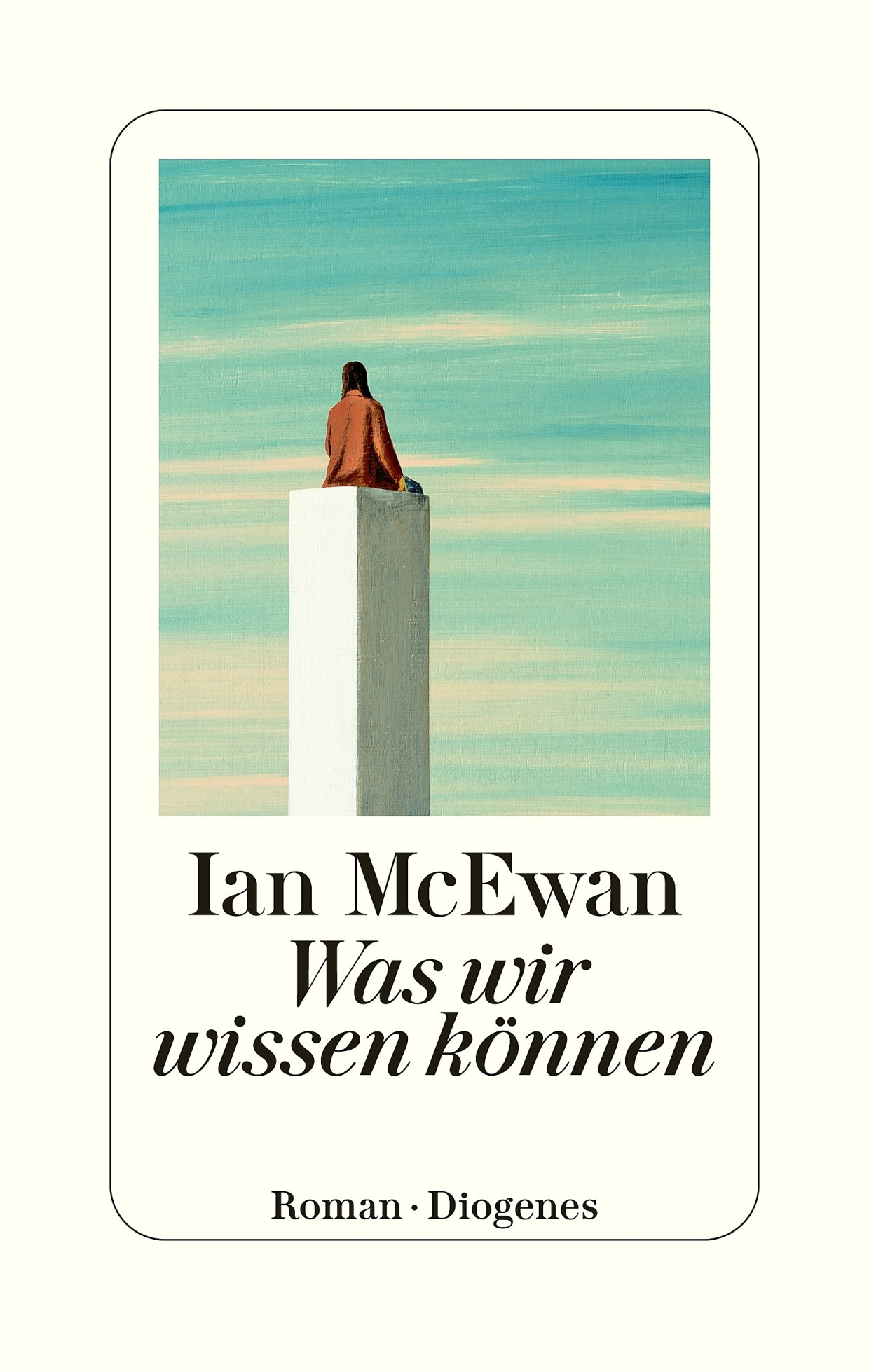
Die utopische Gegenwart des Jahres 2119, in welcher der Roman einsetzt, hat es allerdings in sich. Die Welt steht nach der großen Überflutung von 2042 weitgehend unter Wasser, riesige Landmassen sind verschwunden, viele Millionen Menschen nicht mehr da. Nigeria ist die mächtigste Nation der Erde. Bezahlt wird mit Naira. (Um das Nachschlagen zu sparen: ein Naira entspricht 0,0007 Dollar, aber wer weiß, wie es in hundert Jahren sein wird?) Großbritannien ist nur noch ein Archipel, in dem man mit lahmen Fähren von einer Insel zur anderen fahren kann.
Warum das alles? Weil die Menschen des 21. Jahrhunderts so blöd waren, durch Klimakriege und lokal begrenzten Einsatz von Atomwaffen alles in Unordnung zu bringen. Vorbei mit der Artenvielfalt, die es noch andeutungsweise gab. Die Welt des 22. Jahrhunderts ist ein ruhiger, deutlich langweiligerer Ort geworden. Rose arbeitet an der Uni über „die Realismuskrise in der Literatur zwischen 2015 und 2030“. Und Tom trauert dem chaotischen, verantwortungslosen 21. Jahrhundert mit seinen hitzigen gesellschaftlichen Debatten, seiner widerborstigen Kunst und seinen exquisiten Weinen nach. Er findet, die größte Leistung der Gegenwart, in der er lebt, bestehe darin, „keinen Krieg zu führen“.
Ein Meister des Fallenstellens
Pause. Wie grauenhaft, hätte McEwan einen Roman über das Obige geschrieben! Wer würde ihm das abkaufen? Deshalb tupft er nur ein paar impressionistische Details auf seine Leinwand und verlagert den Systemvergleich zwischen damals und heute in luftige Dialoge zwischen Tom und Rose, wie sie beim Abendbrot stattfinden könnten. Das eigentliche Anliegen, je länger wir lesen, sind zeitlose menschliche Konflikte, für die sich McEwan seit Jahrzehnten interessiert. Und sein Mittel, sie darzustellen, ist ein psychologischer Realismus, der keinen einzigen schwierigen Satz enthält, dessen Funktionieren aber auf einer perfekten Konstruktion beruht: was er erzählt und was er zurückhält; wann und wie er seine Szenen ausklingen lässt; und wo er uns Leser in die sorgfältig präparierte Falle tappen lässt. Kaum einer macht das so gekonnt wie er, und offenbar wirkt seine Erzählkunst so naturwüchsig, dass das Stockholmer Literaturnobelpreiskomitee diesen Briten ohne Exzentrik immer noch für zu leicht befindet.
Dabei traut er sich mehr als viele andere – und mehr, als man beim Lesen zunächst merkt, denn die moralische Wucht seiner Bücher kommt immer in Zimmerlautstärke daher. In seinem Roman „Lektionen“ (2022) schafft er es, die Beziehung zwischen einem Vierzehnjährigen und seiner elf Jahre älteren Klavierlehrerin zu schildern – „erschaffen“ wäre das korrekte Wort –, ohne sich im Mindesten um das gesellschaftlich Skandalöse daran zu kümmern, genau das also, was seine Leser zwangsläufig mitdenken, wenn sie „14“ und „25“ sehen. Er schreibt einfach daran vorbei, weil ihn die Psychologie seiner Figuren viel mehr interessiert, und dieses Interesse, darf man vermuten, hilft ihm dabei, dem Plot so ungeheuerliche Wendungen zu geben.
Auch der Roman „Was wir wissen können“ liefert große McEwan-Momente und Szenen von diabolischer Phantasie. Denn die zweite Hälfte besteht aus dem Tagebuch von Vivien, der Frau des großen Dichters Francis Blundy, und auch wenn McEwan den verschwundenen Sonettenkranz, seinen kleinen Erzählmotor, nie absterben lässt, geht es jetzt im Kern um die Geschichte einer Ehe mit ihren Absprachen und Bequemlichkeiten, ihrem wissenden Schweigen und ihrer inneren Verderbtheit. Und um ein Geheimnis, das keine Rezension andeuten darf.
Dass der Autor selbst es schon auf Seite 40 antippt, aber erst mehr als dreihundert Seiten später hervorholt, in Ruhe auf den Tisch legt, das Packpapier entfernt und dann tut, was er so gut kann wie wenige, all das ist ein weiterer Ausweis seiner Klasse. Längst sind wir wieder in unserem alten 21. Jahrhundert gelandet, der fehlbaren Welt, die wir so genau kennen. Der Schluss ist nicht weit hergeholt, unsere gegenwärtige Spezies sei vielleicht außerordentlich verkommen, liefere aber immer noch den besten Stoff für ernsthafte Literatur.
Ian McEwan: „Was wir wissen können“. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes Verlag, Zürich 2025. 470 S., geb., 28,– €.
