
Wenn man aktuell von „Kriegsgräueln“ spricht, ahnt jeder, was gemeint ist. Es sind Taten, die als Begleiterscheinungen von Kampfhandlungen daherkommen, aber jede Verhältnismäßigkeit überschreiten. So jedenfalls die normative Perspektive. Sie ist geprägt durch jenes Recht und jene Moralität, die sich insbesondere im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert herausgebildet hat. Heute gilt sie als universell und hat ihre Basis im Weltvölkerrecht. Wie passen da die Allgegenwart von Kriegsverbrechen hinein?
Der Tübinger Historiker Dieter Langewiesche hat darauf eine unbequeme Antwort. Er hat sich vor einigen Jahren mit einem gewichtigen Buch im Feld platziert. „Der gewaltsame Lehrer“ sondierte 2019 Europas Kriege in der Moderne. Jetzt hat Langewiesche eine kleine Schrift vorgelegt, die eine These des vielbeachteten Buches vertieft. Sie kommt genau zur richtigen Zeit, weil sie einen Schlüssel zur schockierenden Normalität der Begehung von Kriegsverbrechen auch in Europa liefern könnte.
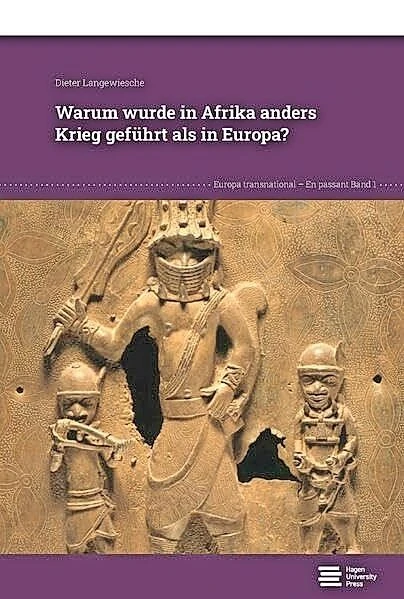
Denn die Erfolgserzählung der Ausbreitung des europäischen Völkerrechts und seiner schützenden Standards zur Kriegführung ist fragwürdig. Europa mag im langen neunzehnten Jahrhundert versucht haben, unnötige Opfer zu vermeiden und exzessive Grausamkeit zu stigmatisieren, kurz: den Krieg zu „zivilisieren“. Aber das war offenbar weder der globale Normalfall noch von langer Dauer. Langewiesche erinnert daran, dass Kolonialkriege etwa in Afrika immer grausam geführt wurden, und auch in Europa wurden (und werden) – wie bekannt – bei Kriegen unzählige Gewaltexzesse begangen.
Langewiesche meint durchaus, die europäischen Kolonialmächte seien in Afrika Täter von entgrenzter Kriegführung gewesen. Aber die europäischen Kolonialtruppen hätten die Entgrenzung nicht erfunden, sondern vorgefunden, und Kolonialkriegserfahrungen seien – entgegen postkolonialer Kritik – keineswegs die Ursache für die spätere, entgrenzte Gewalt im Europa des zwanzigsten Jahrhunderts gewesen. Stattdessen verweist Langewiesche auf die vorkolonialen Kriege in Afrika. Dort habe die traditionelle afrikanische Kriegführung immer angestrebt, in Form des Verheerungskriegs „dem Feind die Lebensgrundlage zu nehmen, einschließlich Frauen und Kinder“. Nicht der Rassismus der Europäer habe diese Kriegsform hervorgebracht, auch wenn koloniale Armeen aus Europa sie praktizierten und Europas militärische Führer in ihr unterwiesen.
Europas Sonderweg
Langewiesches Umkehrung der Perspektive ist radikal und bedenkenswert: Der ungehegte Krieg sei globalgeschichtlich der Normalfall. Dass Europa den „gehegten Krieg“ entworfen und normativ im Kriegsvölkerrecht kodifiziert habe, sei ein „Sonderweg“. Ob das auch über das Empirische hinaus normativ gilt, sagt der Autor nicht. Überhaupt ist das Verhältnis von historischer Empirie und Normativität im Buch nicht eindeutig. Die Tatsache, dass bestimmte Kriegspraktiken herrschten, zwingt keineswegs zu dem Rückschluss auf ihre Billigung durch alle Täter und die Öffentlichkeit. Ferner könnte es doch sein, dass die extreme Herabwürdigung außereuropäischer Feinde eine Schablone für den Umgang mit den europäischen Gegnern wurde und insofern doch koloniale Erfahrungen auch auf innereuropäische Kriegführung zurückwirkten.
Erschreckend lesen sich umso mehr Langewiesches prägnante Aussagen zu historischen Gesetzmäßigkeiten. Aus der Geschichte leitet er ab, dass Menschen immer wieder Kriege führen, daraus Vorteile ziehen, und typisiert die Gründe: um Staaten zu bilden oder zu erweitern oder sie im Inneren revolutionär zu verändern. Imperien weist er eine eigene Rolle zu, die noch erschreckender ist: „Kein Imperium ohne Krieg, keine Auflösung von Imperien ohne Krieg.“ Wenn man das mit Langewiesches nüchternem Blick auf die imperialen Akteure der Moderne kombiniert, versteht man besser, warum sich sowohl Russland als auch die USA mit Kriegsvölkerrecht und Völkerstrafrecht schwertun. Aber wie sollen jene, die einen normativen Fortschritt glauben und ihn nicht preisgeben wollen, dann klug mit Trump und Putin umgehen?
