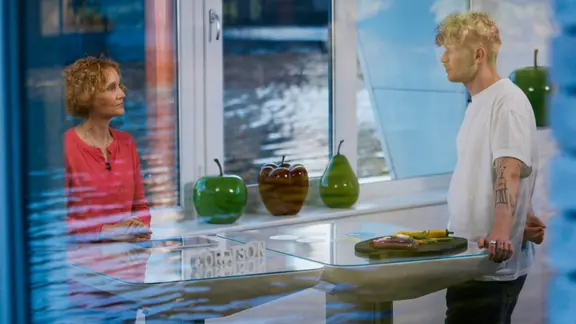Stand: 22.09.2025 16:20 Uhr
| vom
Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist eine allergieähnliche, chronische Entzündung der Speiseröhre. Die bisher nicht heilbare Krankheit beeinträchtigt massiv auch die Lebensqualität von Kindern.
Schluckbeschwerden, verändertes Essverhalten bis hin zu Angststörungen bei Erwachsenen oder Kindern: Das alles können Symptome einer eosinophilen Ösophagitis – kurz EoE (auf Englisch: eosinophilic esophagitis) – sein, einer chronischen Entzündung der Speiseröhre.
EoE: Allergische Erkrankung mit steigenden Fallzahlen
Die EoE ist eine seltene, bisher nicht heilbare Krankheit, die durch allergische Reaktionen auf unterschiedliche Faktoren hervorgerufen wird. Sie ist erst seit Beginn der 1990er-Jahre bekannt. Die Patientenzahlen sind in den vergangenen Jahren aber massiv angestiegen. Nach der Refluxerkrankung ist die eosinophile Ösophagitis die zweithäufigste chronische Entzündung der Speiseröhre und häufigste Ursache für Schluckbeschwerden im jungen Erwachsenenalter.
Häufigkeit und vermutete hohe Dunkelziffer
Die Prävalenz, also die Häufigkeit, wird auf 1:2.000 geschätzt, allerdings gehen Medizinerinnen und Mediziner von einer hohen Dunkelziffer aus. Eine wichtige Rolle spielen eine genetische Veranlagung und unterschiedliche Nahrungs- und Umweltfaktoren. Grundsätzlich sind männliche Kinder und Erwachsene bis zu dreimal häufiger betroffen als Mädchen und Frauen. Die Krankheit tritt familiär gehäuft auf. Neben Erwachsenen erkranken auch Jugendliche und selbst schon Kleinkinder und Säuglinge. Bis zu 70 Prozent der Patientinnen und Patienten sind zudem auch an anderen allergischen Erkrankungen wie Asthma oder Neurodermitis erkrankt.
Eosinophile Ösophagitis: Typische Symptome
Typische Symptome einer EoE sind Schluckbeschwerden bei festen Speisen. Sie reichen von leichten Beschwerden bis zu mitunter mehrstündigem Steckenbleiben von Nahrung in der Speiseröhre. In schweren Fällen muss diese teilweise als Notfall in der Klinik endoskopisch entfernt werden.
Aber es gibt auch weniger ausgeprägte Symptome, wie:
- Brennen der Speiseröhre, oft rasch nach dem Genuss bestimmter Nahrungsmittel
- Brustschmerzen
- Refluxbeschwerden
EoE-Symptome bei Kindern
Bei Kindern variieren die Symptome je nach Alter. So kann eine EoE bei Säuglingen zu Nahrungsverweigerung und in der Folge zu Gedeihstörungen führen, bei Kleinkindern zu Übelkeit, unspezifischen Bauch- oder Brustschmerzen, im Jugendalter treten dann oft die typischen Schluckbeschwerden auf.
Ursache: Bestimmte Nahrungsmittel als Auslöser
Die Erkrankung verläuft oft in Phasen und kann sehr früh, schon im Säuglingsalter, beginnen. Durch Störungen der Schleimhautbarriere der Speiseröhre kommt es zu Reaktionen vor allem auf bestimmte Nahrungsmittel. Das sind in erster Linie Kuh- beziehungsweise Tiermilch, Weizen, Hühnerei, Nüsse, Soja, Fisch und Meeresfrüchte.
Allerdings lassen sich die allergieauslösenden Nahrungsmittel nicht durch klassische Allergietests bestimmen, obwohl viele Kinder mit EoE zusätzlich auch eine klassische Nahrungsmittelallergie aufweisen. Denn bei einer eosinophilen Ösophagitis kommt es – im Gegensatz zu klassischen Allergien vom Sofort-Typ, die durch Immunglobulin-E-Antikörper ausgelöst werden – unter Beteiligung weiterer Immunzellen, wie zum Beispiel den TH2-Helferzellen, zu allergischen Reaktionen ähnlich wie bei Asthma.
Risikofaktoren für eine eosinophile Ösophagitis
Die EoE wird durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren ausgelöst und begünstigt. Dazu gehören zahlreiche Risikofaktoren wie sie für westliche Industriegesellschaften typisch sind: Nahrungsmittel aus industrieller Produktion, Luftschadstoffe, Mikroplastik oder auch Bestandteile aus Waschmitteln und selbst Zahnpasta. Außerdem spielen im Speichel gelöste Pflanzenpollen eine Rolle. Das Risiko einer Erkrankung erhöhen außerdem Frühgeburten, Entbindungen durch Kaiserschnitt oder auch der Einsatz von Antibiotika bei Neugeborenen.
Essverhalten und massiv eingeschränkte Lebensqualität
Oft versuchen EoE-Patientinnen und -Patienten, ihre Probleme durch verändertes Verhalten zu kompensieren. Sie essen zum Beispiel besonders langsam, kauen mehr und länger, verzichten auf bestimmte Nahrungsmittel, schneiden ihr Essen besonders klein, tunken Speisen in Flüssigkeit oder trinken oft nach.
Schreitet die Erkrankung über längere Zeit fort, können Angststörungen und Depressionen hinzukommen. Manche Betroffene trauen sich schließlich nicht mehr, in Gesellschaft zu essen. Insgesamt kann eine EoE die Lebensqualität massiv einschränken.
Diagnose der eosinophilen Ösophagitis
Sind bei entsprechenden Symptomen andere Erkrankungen ausgeschlossen, wird eine Spiegelung der Speisröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms gemacht. Da eine EoE auch vorliegen kann, wenn die Spiegelung unauffällig ist, werden dabei mehrere Biopsien, das sind kleine Gewebeproben, aus unterschiedlichen Stellen der Speiseröhre entnommen und unter dem Mikroskop untersucht.
Finden sich darin bestimmte Blutkörperchen des Immunsystems, die sogenannten eosinophilen Granulozyten, die der Erkrankung ihren Namen geben, ist die Diagnose gesichert. Denn eosinophile Granulozyten sind in der Schleimhaut einer gesunden Speiseröhre normalerweise nicht zu finden. Sie wandern nur bei Entzündungsprozessen ein. Inzwischen weiß man, dass neben den eosinophilen Granulozyten auch andere Immunzellen an den Entzündungsprozessen beteiligt sind.
Späte Diagnose: Mögliche bleibende Einschränkungen
Der „diagnostic delay“, also die Zeitspanne, die vergeht, bis die Krankheit eindeutig diagnostiziert wird, beträgt im Durchschnitt rund vier Jahre – eine lange Zeit, die im Einzelfall noch deutlich länger sein kann.
Wichtig ist aber, die Krankheit möglichst früh zu diagnostizieren. Denn als Reaktion auf die anhaltenden Entzündungsprozesse wird die Schleimhaut der Speiseröhre auf Dauer regelrecht umgebaut. Im Laufe der Erkrankung verliert sie ihre Flexibilität und es können Engstellen entstehen, in denen größere Nahrungsstücke noch leichter hängenbleiben. Wird frühzeitig behandelt, kann das verhindert und begonnene Umbauprozesse oft wieder rückgängig gemacht werden.
EoE bei Kindern: Frühzeitige Diagnose wichtig
Wenn Säuglinge oder Kleinkinder schlechte Esser sind, sich nur zögernd entwickeln, öfter feste Nahrung verweigern und über Brust- oder Bauchschmerzen klagen, sollten Eltern – falls die Kinderärztin oder der Kinderarzt sie nicht sowieso an eine Kindergastroenterologie überweist – von sich aus eine entsprechende Ambulanz oder Klinik aufsuchen, um die Ursache abklären zu lassen.
Drei verschiedene Therapieansätze
Ziel der Therapie ist, die Entzündung zu stoppen. Gelingt das, kann sich die Schleimhaut der Speiseröhre oft so weit regenerieren oder zumindest stabilisieren, dass die typischen Symptome verschwinden. Die Patientinnen und Patienten gewinnen Lebensqualität zurück. Die Therapie ist allerdings grundsätzlich langfristig angelegt. Denn wer an EoE erkrankt ist, wird bei Unterbrechung der Therapie mit großer Wahrscheinlichkeit erneut Entzündungsprozesse und typische Symptome entwickeln. Für die Therapie stehen drei unterschiedliche Ansätze zur Verfügung. Das sind neben Medikamenten die sogenannte Eleminationsdiät und die Dilatation.
Therapie mit Medikamenten: PPI, TCS und Dupilumab
Zur Therapie eingesetzt werden:
- Protonenpumpenhemmer (PPI): Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Therapie der Refluxkrankheit und helfen in hoher Dosierung auch bei der eosinophilen Ösophagitis.
- Topische Kortikosteroide (TCS): Das sind Emulsionen oder Schmelztabletten mit Kortison. Sie wirken direkt an der Schleimhautoberfläche und haben vergleichsweise geringe und gut kontrollierbare Nebenwirkungen.
- Biologikum Dupilumab: Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Antikörper seit 2023 bei Erwachsenen und Jugendlichen über zwölf Jahren sowie seit 2024 auch für Kinder ab einem Jahr zur Therapie eingesetzt werden.
Ausschlussverfahren durch Eliminationsdiät
Langfristig wirksam ist die Eliminationsdiät. Dabei wird gezielt auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet. Klassische Allergietests (IgE-Tests) können die auslösenden Lebensmittel allerdings nicht identifizieren. Eine kleinere neue Studie gibt Hinweise darauf, dass ein Bluttest zur Bestimmung von nahrungsmittelspezifischen Antikörpern vom Typ Immunglobulin G4 (IgG4) bei der Eingrenzung von Auslösern nützlich sein könnte – dadurch könnte sich eine Auslassdiät gezielter auf die Betroffenen abstimmen lassen. Jedoch bedarf es weiterer Forschung, weil die Studienlage zur Rolle von IgG4 bei EoE insgesamt uneinheitlich ist. Noch gelten entsprechende Bluttests nicht als verlässlich.
Beim sogenannten Step-up-Ansatz der Eliminationsdiät wird anfangs nur auf ein Nahrungsmittel, meist Milch, verzichtet. Reicht das nicht aus, kommen weitere Nahrungsmittel hinzu. Bei anderen Ansätzen wird gleich auf mehrere mögliche Auslöser verzichtet, solche Verfahren sollten immer durch eine Ernährungsfachkraft begleitet werden.
Minimalinvasiver Eingriff: Dilatation
Wenn sich Gewebestrukturen der Speisröhre bereits verändert haben und Engstellen entstanden sind, können diese in einem endoskopischen Eingriff mit einem wassergefüllten Ballon kontrolliert mechanisch wieder aufgedehnt werden. Zusätzlich werden dabei aber immer Medikamente gegen die Entzündung eingesetzt
Biomarker als Forschungsziel
Die Wirksamkeit der Therapien muss regelmäßig kontrolliert werden. Da das zuverlässig bisher nur mit Biopsien möglich ist, wird geforscht, ob es Biomarker gibt, die eine Entnahme von Gewebeproben vielleicht ersetzen könnten. Noch ist das aber Zukunftsmusik.
Normale Lebenserwartung trotz EoE
Die Krankheit ist nicht heilbar, aber die gute Nachricht ist: Wird sie frühzeitig behandelt, können die chronische Entzündung gestoppt und Gewebeveränderungen oft wieder rückgängig gemacht werden. Symptome werden reduziert oder verschwinden ganz und Patientinnen und Patienten gewinnen Lebensqualität zurück. Außerdem müssen Betroffene nicht mit einer geringeren Lebenserwartung als gesunde Menschen rechnen.