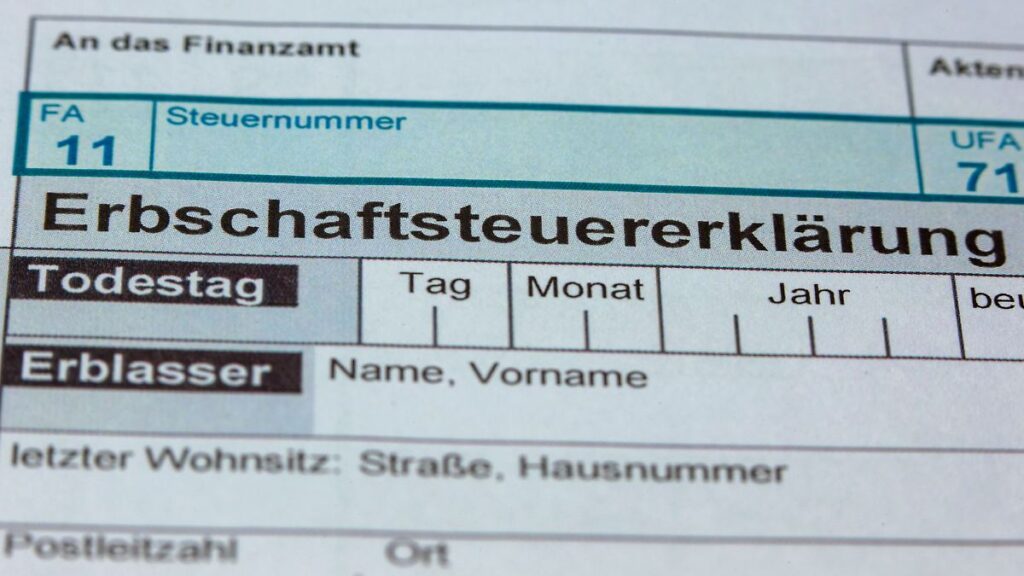
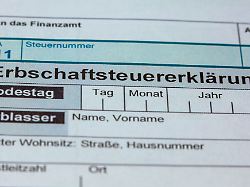
Debatte um Steuergerichtigkeit
Das gilt aktuell bei Erbschafts- und Schenkungsteuer
19.09.2025, 14:11 Uhr
Artikel anhören
Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Mehr Infos
Wer in einem Testament nicht bedacht worden ist, findet Trost in dem Gedanken, dass der Verstorbene ihm vermutlich die Erbschaftssteuer ersparen wollte. Aber obwohl Erbschaften und Schenkungen grundsätzlich steuerpflichtig sind, gibt es zahlreiche Freibeträge, Ausnahmen und Sonderregelungen. Hier sind sie.
Höhere Abgaben auf geerbtes Vermögen sind eigentlich eine klassische Forderung linksgerichteter Politiker. Zuletzt überraschte Unions-Fraktionschef Jens Spahn mit Äußerungen zu einer möglichen Erbschaftsteuerreform – bei der Vermögensverteilung sei die Frage, „wie man auch da eine größere Gerechtigkeit herstellen kann“, sagt er. Die Regelungen beschäftigen auch das Bundesverfassungsgericht. Aktuell gilt: Erbschaften und Schenkungen sind grundsätzlich steuerpflichtig, es gibt jedoch zahlreiche Freibeträge, Ausnahmen und Sonderregelungen. Besonders Firmenerben profitieren stark.
Freibeträge
Je nach Verwandtschaftsverhältnis gibt es bei Erbschaften einen Freibetrag zwischen 20.000 und 500.000 Euro. Gleiches gilt auch für Schenkungen. Dort können zudem die Freibeträge alle zehn Jahre voll ausgeschöpft werden. Eltern können ihren Kindern beispielsweise alle zehn Jahre bis zu 400.000 Euro steuerfrei schenken und so die Steuerlast im späteren Erbfall deutlich senken. Weitere Freibeträge für Erbschaften oder Schenkungen können etwa im Fall von pflegenden Angehörigen gewährt werden.
Kettenschenkungen
Auch sogenannte Kettenschenkungen bieten Potenzial zum Steuersparen: Wenn beispielsweise eine Großmutter ihrer Enkelin Geld schenken will, während ihre Tochter und Mutter der Enkelin noch lebt, gilt ein niedrigerer Freibetrag. In diesem Fall kann die Großmutter das Geld ihrer Tochter schenken, die es wiederum an ihre Tochter weitergibt.
Steuerbefreiungen
Das selbst genutzte Eigenheim ist unter Umständen steuerbefreit: Wer mindestens zehn Jahre nach dem Tod des Ehepartners im geerbten Haus wohnt, muss keine Erbschaftssteuer zahlen. Für Kinder oder Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, gilt dies ebenfalls, allerdings nur, wenn die Wohnfläche maximal 200 Quadratmeter beträgt. Weitere begrenzte Steuerbefreiungen gibt es für Hausrat wie Bücher und Möbel.
Höhe der Erbschaftssteuer
Der Erbschaftsteuersatz richtet sich nach der Steuerklasse und nach dem Wert des Erbes oberhalb eventueller Freibeträge. Die Steuerklasse richtet sich wiederum nach dem Verwandtschaftsgrad: In die niedrigste Steuerklasse fallen Ehegatten sowie Erben in direkter Linie (Eltern, Kinder, Enkel). Für Geschwister und deren Kinder, Stief- und Schwiegereltern, Schwiegerkinder sowie geschiedene Ehepartner gilt Steuerklasse II, für alle anderen Erben Steuerklasse III.
Der niedrigste Satz sind sieben Prozent für Werte bis 75.000 Euro in Steuerklasse I. In der Steuerklasse II liegt der niedrigste Satz bei 15 Prozent, in der Klasse III bei 30 Prozent. Für Millionenvermögen werden in der niedrigsten Steuerklasse 19 bis 30 Prozent Steuern fällig, in der mittleren mindestens 30 Prozent und in der höchsten meist der Maximalsatz von 50 Prozent. Entsprechende Sätze gelten jeweils auch für Schenkungen.
Erbschaftssteuer für Unternehmen
Aus Furcht vor starken Belastungen für Familienunternehmen in Erbschaftsfällen gibt es zahlreiche gesetzliche Begünstigungen für Firmenerben. Grundsätzlich gilt, dass die prozentuale Steuerbefreiung umso höher ausfällt, je größer das zu vererbende Betriebsvermögen ist. In manchen Fällen sind Betriebsvererbungen gänzlich steuerbefreit. Die Begünstigungen gelten im Gesamtumfang als größte Steuersubvention in Deutschland.
Einnahmen aus der Erbschaftsteuer
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld als je zuvor aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer eingenommen. Gegenüber 2023 stiegen die Einnahmen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 12,3 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. Insbesondere mit einer Reform der Regelungen für Firmenerben könnten diese Einnahmen jedoch erheblich gesteigert werden.
Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, beziffert das Einnahmepotenzial für den Fiskus auf rund fünf Milliarden Euro. Dabei gehe es nicht um die Freibeträge für Erbschaften normaler Vermögen, sondern um „überwiegend große Vermögen im Millionen- oder Milliardenbereich“, betont er.
Erbschaftsteuer beschäftigt Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht hat die Bevorzugung von Firmenerben im Steuerrecht bereits zwei Mal – 2006 und 2014 – als verfassungswidrig eingestuft. Gesetzliche Änderungen 2008 und 2016 führten aber nur zu Anpassungen im Detail. Derzeit ist ein weiteres Verfahren in Karlsruhe anhängig, bei dem es um die Frage der Vereinbarkeit der Begünstigungen für Firmenerben mit dem Grundgesetz geht. Eine Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet.
