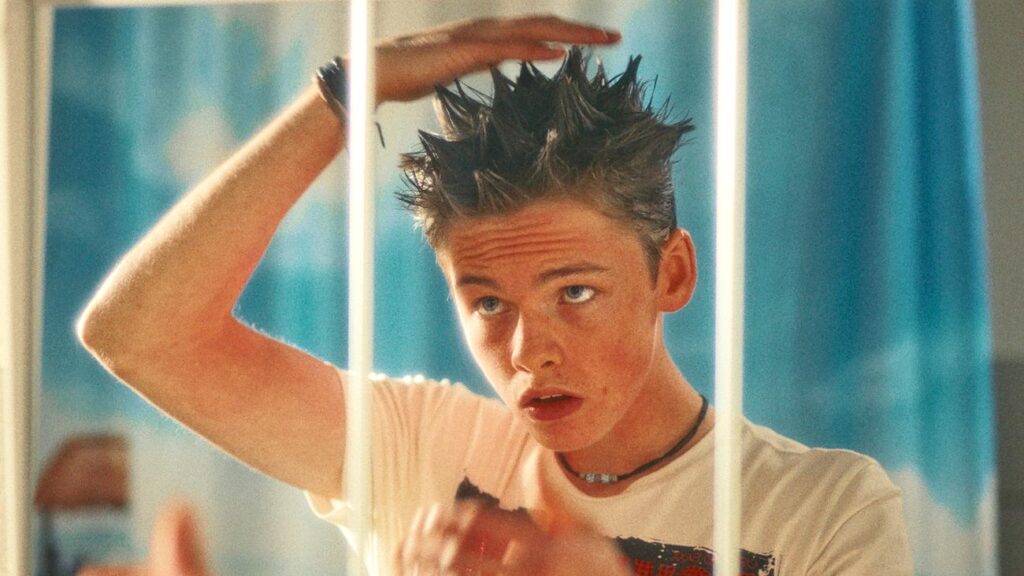
Im Radio Britney Spears und Christina Aguilera, an den Füßen Buffalos und über der Hüftjeans ein Arschgeweih: In der ZDFneo-Serie Chabos muss der
36-jährige Nicko Pfeffer, genannt Peppi, erkennen, dass sein Blick auf die
eigene Nullerjahre-Jugend verklärt ist. Die Hauptfigur der Show,
gespielt von Johannes Kienast, ist ein typischer Millennial, ein Vertreter
jener Generation, die, wie er selbst sagt, „auf Dating-Apps hängt und sich
nicht für irgendwas entscheiden kann, nicht für Kinder, nicht für ’nen
Job“. Passend dazu beginnt Chabos mit dem Ende einer Affäre, die
Peppi an seinem Arbeitsplatz hatte. Die Frau schießt ihn ab, weil sie sich mehr
als ein paar Wochen Spaß mit dem Berufsjugendlichen nicht vorstellen kann. Kurz
darauf ein zweiter Schock: In einer Karaoke-Bar trifft Peppi einen alten
Schulkameraden und erfährt, dass er nicht zum bevorstehenden Klassentreffen
eingeladen wurde. Für jemanden, der seine Schuljahre für „so ’ne geile
Zeit“ hielt, ist das ein Affront. Noch in derselben Nacht fährt Peppi
zurück in seine Duisburger Heimat, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Während er in der Gegenwart ehemalige Freunde, Bekannte
und Liebschaften aufsucht, erzählt Chabos in Rückblenden – im
nostalgischen 4:3-Format – von seiner Jugend. Der 16-jährige Peppi (Nico
Marischka) schlägt die Zeit mit seinen Chabos tot, seinen Kumpels also, von
denen jeder ein Stereotyp repräsentiert, wie man sie aus vielen Coming-of-Age-Filmen und -Serien kennt: P.D. (Jonathan Kriener) ist der Macho,
Gollum (Arsseni Bultmann) der Nerd und Alba (Loran Alhasan) der geheimnisvolle
Außenseiter. Peppi fällt durch Gelfrisur und leichten Hang zur
Selbstüberschätzung auf.
Die Welt, die
die Jungs umgibt, wimmelt vor Nullerjahre-Referenzen. Die Clique veranstaltet
Lan-Partys, nimmt an einer DSDS-ähnlichen Castingshow teil und lernt ein
Mädchen kennen, dessen Vater mit Crazy-Frog-mäßigen Klingeltönen reich
geworden ist. Der Soundtrack unterstreicht diese Inszenierung: von Limp Bizkit
über die No Angels bis zu Evanescence ist er mit Hits aus der damaligen Zeit
beladen. Fast möchte man deshalb glauben, dass ein Großteil des Serienbudgets
in Musiklizenzierungen geflossen sein muss. Wie man heute zu den Songs der
damaligen Zeit steht, ist unerheblich. Ohrwürmer hatte das Jahrzehnt auf jeden
Fall.
Chabos basiert lose
auf der britischen BBC-Produktion Ladhood von und mit Liam Williams,
übernimmt von dieser den quasselstrippigen Erzähler, der sich in direkter
Ansprache an das Publikum wendet sowie den liebevoll-ironischen Blick auf eine
Jugend, die sich als viel düsterer herausstellt, als man sie in Erinnerung
hatte. Davon abgesehen ist Ladhood aber so britisch, dass es unmöglich gewesen wäre, die Serie einfach auf deutsche Gepflogenheiten umzumünzen. Was Chabos auf abstrakter Ebene mit
seinem britischen Vorbild verbindet, ist der Sozialrealismus. Hinter der
poppigen 2000er-Oberfläche lugen Probleme des wahren Lebens hervor.
Peppis Vater hat seinen Job verloren, die Eltern (Anke
Engelke und Peter Schneider) drohen sich zu trennen. P.D. wird von seinem alkoholkranken und gewalttätigen Vater
vernachlässigt, Gollums Vater sitzt im Rollstuhl, und der Kurde Albo
(eigentlich Anis) bleibt für alle nur „der Türke“. Und dann wäre da
noch ein illegaler Download des Horrorfilms Saw 2, der Peppis Familie
endgültig in den Ruin zu treiben droht. Chabos setzt sich mit solchen
Handlungselementen zwischen die Genre-Stühle: Die Serie ist nie ganz
2000er-Nostalgie-Komödie oder ernst zu nehmendes Sozialdrama. Sie ist beides
gleichzeitig.
Das wahre Sommermärchen? YouPorn!
Der gesellschaftskritische Ansatz von Chabos geht
sogar so weit, dass sich die Serie auf kulturelle Spurensuche begibt. Der
erwachsene Peppi erklärt etwa, dass das wahre Sommermärchen von 2006, jenem
Jahr, in dem die Rückblenden spielen, nicht die Fußball-WM „im eigenen
Land“ war, sondern der Start von YouPorn. Beides steht in der Serie symbolisch
für den Beginn von etwas Dunklem, für den deutschen Rechtsruck und eine Generation toxischer
Männer. Obwohl sich Peppi in der Gegenwart von Chabos größtenteils
geläutert gibt, gilt für ihn in Sachen Rapmusik noch immer: härter ist besser.
Im Kern sei Peppi eben „ein typischer Millennial,
der nach Freiheit und Selbstverwirklichung sucht, aber in Codes aus Gewalt,
Coolness und Machogehabe erzogen wurde“, sagen die Köpfe hinter der Serie, das Regie-
und Autorenduo Mickey Paatzsch und Arkadij Khaet, im Pressematerial zu Chabos. Obwohl das
verallgemeinernd klingen mag, sind es Momente der Ambivalenz und Selbstkritik,
die zu den besten der Serie gehören. Man wünschte, diese wären noch weiter
vertieft worden. Dennoch gelingt es Chabos, die Ratlosigkeit und leichte
Verzweiflung seiner Hauptfigur nachvollziehbar zu machen. Voller Melancholie
fragt Peppi am Ende seiner Ausführungen zum Sommermärchen 2006: „Aber hat
es uns geschadet?“ Die Antwort darauf muss das
Publikum für sich selbst finden.
Paatzsch und Khaet haben schon mit dem Kurzfilm Masel
Tov Cocktail (2020) gezeigt, dass sie Popkultur und politischen Ernst
miteinander verbinden können. Ihre Handschrift ist auch in Chabos zu
erkennen, durch Ruhrpottkulisse, visuellen
Einfallsreichtum und mutige Verbindungen von Humor und Tiefgang. Am Ende von Chabos führen sie Peppi und wohl auch einige
Mit-Millennials an Fernseher oder Laptop zu einer bitteren Erkenntnis: In
ihrer Jugend war wohl doch nicht alles so geil. Trotz aller Nostalgie und den
Lachern über igelartige Gelfrisuren, alberne Klingeltöne und fragwürdige
Outfit-Entscheidungen bleibt die Serie eine Warnung. Wer
sich an die Vergangenheit klammert, endet in der Gegenwart als trauriger
Erwachsener.
Die acht Folgen von „Chabos“ sind in der ZDF Mediathek verfügbar. ZDFneo strahlt die Serie am 24. und 31. August sowie
am 7. September jeweils um 20.15 Uhr aus.
