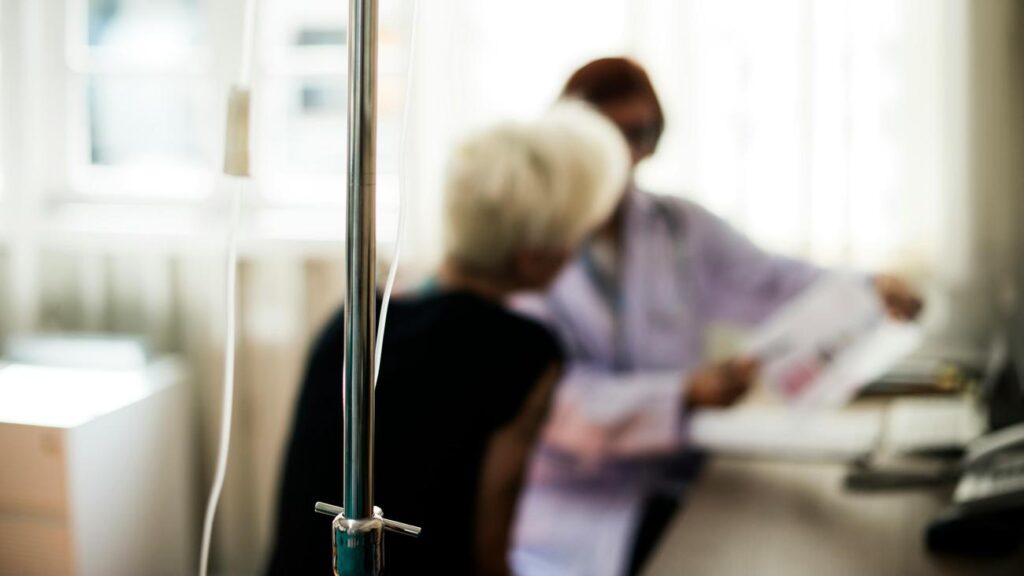
Wer sich mit Fieber schon mal ins Wartezimmer geschleppt hat, nur um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für die Firma zu besorgen, weiß: Das hat mit Medizin wenig zu tun – und mit gesund werden im Grunde gar nichts. Man steckt höchstens andere Menschen an und sorgt für viel Arbeit in der Arztpraxis. Es ist daher an der Zeit, die Attestpflichtkultur zu beenden. Das schlägt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, vor, der die ärztliche Bescheinigung erst ab dem vierten oder fünften Krankheitstag fordert.
Der Vorschlag ist vernünftig und trifft die Realität in den Hausarztpraxen – und die der Beschäftigten. Besonders klug ist, dass Gassen gar keine gänzlich neue Rechtslage fordert, sondern vor allem einen anderen Umgang mit den schon heute gültigen Spielräumen. Das Entgeltfortzahlungsgesetz verlangt nämlich eine ärztliche Bescheinigung erst, wenn die Krankheit länger als drei Kalendertage dauert; Arbeitgeber dürfen sie zwar früher anordnen – das hat auch das Bundesarbeitsgericht bestätigt –, aber sie dürfen dies nicht willkürlich oder diskriminierend tun.
Dennoch gibt es Firmen, die aus der Ausnahme eine Regel gemacht haben und pauschal eine AU ab dem ersten Tag verlangen. Zudem hat sich in der Arbeitskultur der Deutschen die Attestpflicht eingeschlichen: Viele Beschäftigte besorgen sich ein Attest selbst dann, wenn es der Betrieb gar nicht einfordert, aus Pflichtgefühl, Sorge um den Arbeitsplatz oder Gewohnheit. Das hat Folgen: Jedes Jahr werden laut der KBV rund 116 Millionen Krankschreibungen ausgestellt; gut ein Drittel davon dauert maximal drei Tage. Streicht man diese Kurzbescheinigungen, würde dies nach KBV-Rechnung 1,4 Millionen Arztstunden und rund 100 Millionen Euro sparen – Zeit und Geld also, die dorthin gehören, wo Medizin wirklich nötig ist.
Von Vertretern der Arbeitgeber kam auf den Gassen-Vorschlag prompt Kritik. „Eine pauschale Verlängerung der Karenzzeit würde die Arbeitgeberseite zusätzlich belasten, ohne die strukturellen Probleme zu lösen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen sollten die Patientinnen und Patienten in den Praxen „besser gesteuert“ werden. Was das konkret bedeutet, führte Kampeter aber nicht aus. Geht es nach der BDA, ginge es in eine ganz andere Richtung: Das den Arbeitgebern nahestehende Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hatte einen Karenztag für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gefordert. Der erste Tag einer Krankheit soll demnach unbezahlt sein.
Attestpflicht führt zu Präsentismus mit vielen Nachteilen
Aber wer kurzfristige Krankheitstage mit Karenztagen verhindert, riskiert Präsentismus: Menschen kommen krank, stecken Kolleginnen und Kollegen an, fallen am Ende länger aus. Das ist betriebswirtschaftlich teurer, als zwei oder drei Tage konsequent auszukurieren. Zudem zeigt der internationale Blick: Deutschland ist beim Krankenstand kein Ausreißer nach oben, sondern liegt im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld. Die große Welle an Blaumachern, die gern beschworen wird, bleibt bis heute ohne Beleg. Hoch sind eher die Infektwellen und die Lasten einer alternden Belegschaft – beides Probleme, die man nicht mit mehr Attesten löst. Die viel kritisierte telefonische Krankschreibung hat die Praxen nachweislich entlastet – und sie ist nicht der Grund für hohe Krankenstände. Große Kassen und Studien finden keine Hinweise auf systematischen Missbrauch; 2022/2023 lag der Anteil telefonischer Bescheinigungen bei 0,8 bis 1,2 Prozent. Sehr viel höher dürfte auch die Krankenquote nicht ausfallen, wenn erst ab dem vierten oder fünften Fehltag ein Attest erforderlich wird.
Besonders entlasten würde ein Verzicht auf die Pflichtbescheinigung Familien mit kleinen Kindern. Wer heute Kinderkrankentage braucht, muss ein ärztliches Attest vorlegen – faktisch von Tag eins an. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert das seit Langem als „unnötigen Einsatz pädiatrischer Ressourcen„. Seit dem 1. Juli 2024 hilft immerhin die telefonische Krankschreibung auch hier – unter strengen Bedingungen und befristeter Dauer; das Kind muss etwa jünger als zwölf sein, schon zu den Bestandspatienten gehören, maximal fünf Tage sind möglich. Aber die Pflicht als solche bleibt. Sie bindet Zeit, die Kinderärztinnen und Kinderärzte für richtige Diagnostik und Behandlung brauchen. Fachärzte, die ohnehin schon bundesweit fehlen.
Worum es wirklich geht? Die Antwort ist einfach: um Vertrauen. Arbeitgeber haben nichts zu befürchten, sondern eher zu gewinnen: Vertrauen und damit Loyalität und Motivation bei den Beschäftigten. Chefs, die strenger sein wollen, dürften dies auch künftig: Das Weisungsrecht des Arbeitgebers bleibt unberührt von Anpassungen im Entgeltfortzahlungsgesetz. Eine klare, einfache Regel – Bescheinigung erst ab Tag vier oder vielleicht sogar fünf – setzt daher das richtige Signal: Eigenverantwortung statt Misstrauen, Erholung statt Präsentismus, Medizin statt Verwaltung und weniger Bürokratie für alle.
