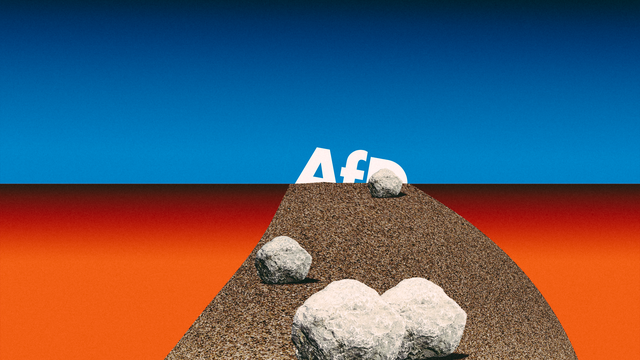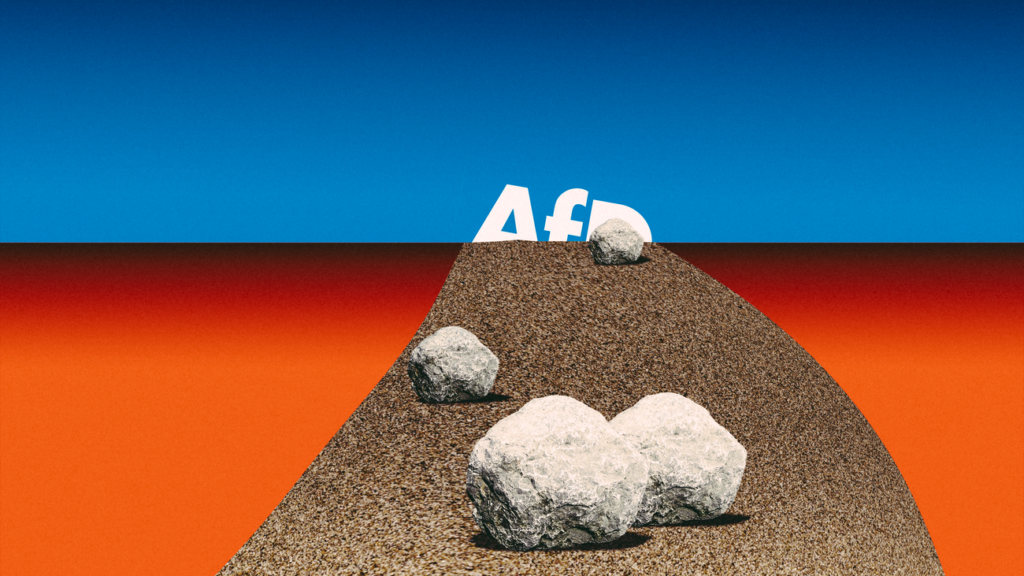
Für die SPD selbst war ihr Beschluss zu einem
Verbotsverfahren gegen die AfD wichtig. Zum Ende ihres Parteitags, auf
dem sie lang und breit über eine Rückkehr der Wehrpflicht stritt und ihren
Parteichef abstrafte, kam es doch noch zu einem Moment der Einigkeit: Alle SPD-Delegierten
votierten für einen Antrag, mit dem ein AfD-Verbot vorbereitet werden soll. Für
diesen Moment wirkte die SPD mit sich selbst im Reinen.
„Das war ein wichtiges Signal, dass nun auch unsere
Parteispitze hinter der Prüfung eines Verbotsverfahrens steht“, sagt Carmen
Wegge am Tag danach der ZEIT. Sie wirbt als Rechtspolitikerin im Bundestag seit Langem für ein gemeinsames Vorgehen der Fraktionen gegen die AfD. „Jetzt
geht es darum, dass sich die Union auch endlich fachlich mit Fragen eines
möglichen AfD-Verbots auseinandersetzt.“
Die SPD setzt also ihren Koalitionspartner unter Druck: Der Umgang mit der rechtsextremen Partei ist erneut ein Thema, über das sich
Schwarz-Rot verständigen muss. Doch ob der Beschluss von Sonntag tatsächlich
konkrete Folgen hat, ist ungewiss. Denn obwohl der Bundesverfassungsschutz die
AfD auf Bundesebene erst kürzlich als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft hat,
ist in der politischen Mitte kein hinreichender Wille auszumachen, ein Verbot
der Partei anzustreben.
Einen Koalitionskrach gebe es jedenfalls nicht, heißt es nun
nach dem Parteitag. Die SPD habe sich ja „nicht für ein sofortiges
AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen“, betonte Regierungssprecher Stefan
Kornelius.
Mit einer Arbeitsgruppe begann das letzte Parteiverbotsverfahren
Tatsächlich geht es im Beschluss der SPD nur darum, eine
Arbeitsgruppe von Bund und Ländern einzusetzen, die einen möglichen
Verbotsantrag mit Material anfüttert, das eine Verfassungsfeindlichkeit belegen
soll.
Doch schon dieser Schritt geht der Union zu weit: Bundesinnenminister
Alexander Dobrindt (CSU) machte prompt klar, er fühle sich an den Beschluss auf
dem Parteitag seines Koalitionspartners nicht gebunden.
Tatsächlich hatte sich Dobrindt mit seinen Amtskollegen in
den Ländern erst vor drei Wochen darauf geeinigt, eine derartige Arbeitsgruppe
einzusetzen – allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden: Sie soll erst
zusammentreten, sobald ein Gericht die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz bestätigt hat – und sie soll sich dann um
praktische Fragen kümmern, etwa ob AfD-Mitglieder Beamte sein und Waffen behalten
können.
Auch wenn der genaue Auftrag einer Arbeitsgruppe wie eine
Nebensache klingen mag – er hat Symbolcharakter. Mit einer Beauftragung einer
Bund-Länder-Gruppe, wie sie die SPD nun will, begann im Jahr 2012 auch das
zweite Verbotsverfahren gegen die NPD – das letztlich scheiterte. Die Gruppe
könnte also eine Vorstufe zu einem Verbotsverfahren sein. Das können die
Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat mit Mehrheit beschließen.
Doch eine solche Mehrheit ist nicht abzusehen.
Zwar schließt sich die SPD mit ihrem Votum einer Forderung
der Grünen an – doch ohne Zustimmung der Union wird es in der Frage keine
Bewegung geben. Und in Reihen von CDU und CSU ist die offizielle Linie klar,
sie lautet: Ein Verbotsverfahren ist nicht gewünscht.
Merz: Es rieche nach „Konkurrentenbeseitigung“
Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich
immer wieder ablehnend. „Das riecht mir zu sehr nach politischer
Konkurrentenbeseitigung“, sagte er etwa Mitte Mai der ZEIT auf die Frage
nach einem möglichen Verbot der AfD. CSU-Politiker Dobrindt warnte vor einer etwaigen Opferrolle der AfD. In der Union fürchtet man, allein
die Einleitung eines Verfahrens könnte schon konservative Anhänger in die Arme
der AfD treiben.
Die Losung lautet stattdessen, über gutes Regieren den
Zuspruch zur AfD zu verkleinern. „Die Probleme bei der Migration und bei
der Wirtschaft zu lösen, das ist das beste Mittel, um Wähler von der AfD
wegzubringen“, sagt Steffen Bilger, der parlamentarische Geschäftsführer der
Union. Die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz
brachte auch in der Union einige zum Nachdenken. Doch das zugrunde liegende
Gutachten des Verfassungsschutzes, das wenige Tage später bekannt wurde und die
wohl wichtigste Grundlage für ein mögliches Verbotsverfahren der AfD wäre, sei
nicht überzeugend und nicht ausreichend, lautet ein verbreitetes Urteil in
Reihen der Union.
Dabei gibt es auch in der CDU längst Stimmen, die sich für
ein AfD-Verbotsverfahren aussprechen. Meist sind es Vertreter vom liberalen
Parteiflügel, wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther
oder der Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmervereinigung, Dennis Radtke. Auch Hendrik
Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat sich offen
gezeigt. Und im Bundestag haben einzelne Abgeordnete für ein
Verbotsverfahren geworben.
Doch die einst lautesten Befürworter aus den Reihen der Unionsfraktion
sind aus dem Bundestag ausgeschieden. Und die große Mehrheit folgt der
Merzschen Wir-lösen-die-Probleme-Linie.
Sie dürften in diesen Tagen Bestätigung aus den aktuellen
Umfragen ziehen: Nachdem die Union vor wenigen Wochen befürchten musste, von
der AfD überholt zu werden, konnten CDU und CSU nach dem Start der
Bundesregierung zuletzt wieder leicht zulegen – und die AfD deutlich auf
Distanz halten: Sieben Prozentpunkte trennten sie bei der jüngsten Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen.
Warten auf ein Urteil
Die Skeptiker aus der Union verweisen auch auf das Urteil zur rechtsextremen
Zeitschrift Compact. Das von der früheren Bundesinnenministerin Nancy Faeser
(SPD) angestrengte Verbot wurde vergangene Woche kassiert – auch wenn Compact zahlreiche
verfassungswidrige Aussagen nachgewiesen wurden, seien diese nicht „prägend“
für die Zeitschrift gewesen, lautete ein zentrales Argument der Richter am
Bundesverwaltungsgericht. Ungleich schwieriger dürfte es werden, der AfD als
Ganzes ein planvolles Vorgehen gegen die freiheitlich-demokratische
Grundordnung nachzuweisen, und ungleich folgenreicher wäre ein Scheitern.
Denn, so die Warnung der Union: „Wenn ein solcher Antrag vor
dem Bundesverfassungsgericht scheitert, wird die Partei nicht geschwächt,
sondern politisch aufgewertet“, sagt Günter Krings, der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende. „Sie kann sich dann als vermeintlich ‚gerichtlich rehabilitiert‘ inszenieren – das wäre brandgefährlich.“
Doch für die SPD-Politikerin Wegge sind dies keine Argumente,
die gegen eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern sprechen. „Wir werden kein Verbotsverfahren anstrengen,
wenn es keine Aussicht auf Erfolg gibt“, entgegnet sie. „Um die Aussichten beurteilen zu können, braucht es die Arbeitsgruppe mit einem klaren Auftrag.“
Bei der Union wäre, wenn überhaupt, erst dann Bewegung
zu erwarten, wenn die Einstufung der AfD durch den Bundesverfassungsschutz vom Gericht bestätigt worden ist. Die AfD hatte gegen die Hochstufung von einem
Verdachtsfall zur „gesichert rechtsextremen“ Partei geklagt, der
Inlandsnachrichtendienst daraufhin eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben:
Solange über den Eilantrag der AfD nicht entschieden ist, lässt der Verfassungsschutz die Hochstufung ruhen. Und solange diese juristische Frage
nicht geklärt ist, dürfte auch die politische Debatte in der Mitte nicht
vorankommen.