
Eine Bewerbungsrede für den Vorsitz der Jungen Sozialisten ist kein Oberseminar. Entsprechend holte Philipp Türmer im November vergangenen Jahres auch rhetorisch aus: „Ich will, dass denen das Lachen vergeht und dass die wieder Angst vor uns haben.“ Stürmer wurde mit 66,2 Prozent gewählt. Bei seinem Zitat, das mit einer Suggestion von Gewalt spielt, muss man wohl jugendlichen Überschwang in Rechnung stellen.
Für einen Teil der politischen Linken, die nach Orientierung sucht, ist Stürmer aber durchaus repräsentativ. Denn „die Reichen“ sind zu einem Hoffnungsträger geworden in einer Situation, in der das marxistische Klassenschema nicht mehr so richtig passt. Auch Jan van Aken von der Linkspartei findet, dass es „keine Milliardäre“ geben sollte, was wohl so zu verstehen ist, dass solche Vermögen entsprechend zu besteuern seien.
Die Superreichen zahlen verhältnismäßig wenig Steuern
In beiden Fällen kann man einen Gedanken unterstellen: Deutschland ist enorm reich, blickt man auf das gesamte „Ersparte“ und Investierte, gleichzeitig hakt es bei den finanziellen Erfordernissen der öffentlichen Hand. Steuert der subsidiäre Staat vielleicht auf eine strukturelle Unterfinanzierung zu?
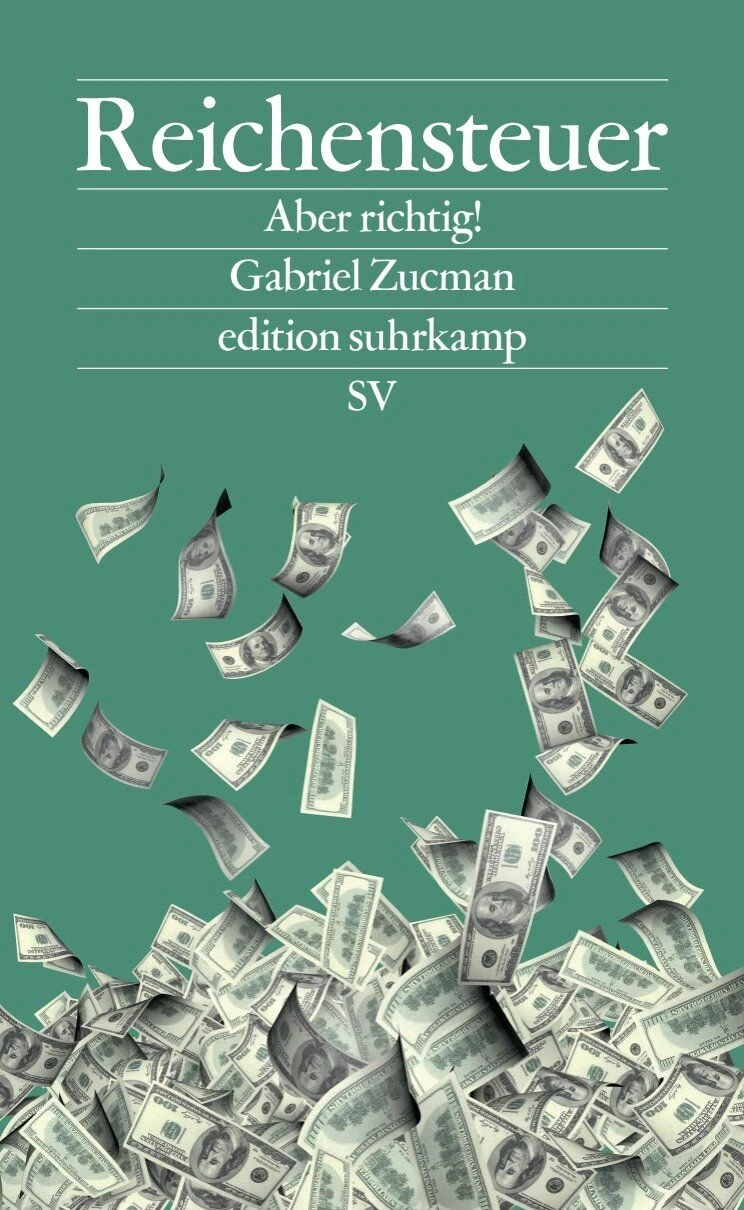
Der französische Publizist und in Berkeley lehrende Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman verwendet in seiner Flugschrift über eine „Reichensteuer“ einen ehrwürdigen Begriff. Er spricht von „nationaler Solidarität“ und sieht sie gefährdet, wenn reiche Menschen sich dem Gleichheitsgrundsatz entziehen können. Der sei nämlich auch auf die Besteuerung anzuwenden, und da zeige sich, dass sehr reiche Menschen proportional deutlich weniger Abgaben entrichten als Menschen, die vorwiegend von Arbeitseinkommen leben. Vor allem eine Gruppe sticht hervor, die numerisch sehr klein ist: Milliardäre hätten in Frankreich eine Abgabenquote von 13 Prozent, während sie bei der Mittelschicht bei grob gerechnet 50 Prozent liege.
Zwei Prozent des Vermögens sollen an den Staat gehen
Nun aber konzentriert sich Zucman auf Frankreich als Modellfall für eine westliche Nationalökonomie, für die er eine konkrete Reichensteuer entwirft, die den Schwierigkeiten vieler bisheriger Vermögensteuern entgehen soll. Für Deutschland spielt er in einem Vorwort eigens eine Anwendung durch. Aber das Modell sollte darüber hinaus übertragbar sein. Der österreichische Finanzminister Markus Marterbauer ließ die Öffentlichkeit jedenfalls vor einiger Zeit wissen, dass Zucmans Intervention von ihm als Wochenendlektüre eingeplant war.
Zucman fasst sich sehr knapp, steuert schnell auf eine Schnittstelle zu, an der auch Modelle zu Erbschaftsteuern und generell Abschöpfungsbemühungen bei sehr hohen Vermögen landen. Milliardäre sind zwar in der Regel äußerst reich, aber es ist nicht immer klar, wie viel sie einnehmen. Entsprechend zahlen sie häufig vergleichsweise wenig bis gar keine Einkommensteuern, denn ihr Vermögen liegt in Unternehmensbesitz, und sie lukrieren Dividenden, für die sich aber leicht Bilanzierungen finden, damit sie nicht in die individuelle Steuererklärung eingehen.
Zucmans Vorschlag besteht im Wesentlichen darin, Personen, deren Vermögen 100 Millionen Dollar und mehr beträgt, eine Steuer von zwei Prozent auf den Vermögenswert aufzuerlegen, abzüglich „regulär“ bezahlter Einkommensteuer, Sozialbeiträge oder Immobiliensteuer. Zucman ist überzeugt, damit einen Durchbruch gegen Steueroptimierung erreichen zu können. Seinen Vorschlag hat er vor zwei Jahren den G20 vorgelegt, wie er eigens erwähnt.
So könnte eine Reichensteuer für Deutschland aussehen
Für ein interessiertes, nicht spezialisiertes Publikum könnte vor allem eine Zahl von Interesse sein. Zucman berechnet für Deutschland die Einkünfte aus einer „Reichensteuer“ mit 17 Milliarden Euro. Das ist nicht nichts, deckte aber nicht einmal die Ausgaben des Bildungsministeriums, das im Bundeshaushalt 2025 viereinhalb Prozent beansprucht. Das starke Wachstum riesiger Vermögen würde von Zucmans moderatem Vorschlag, der zudem umfangreiche Vorkehrungen gegen Steuerflucht voraussetzt, kaum betroffen, oder vermutlich wäre bald eine Nachjustierung des vorgeschlagenen Prozentsatzes erforderlich.
Kein Wunder deshalb, dass anderenorts wesentlich rigidere Konzepte ins Spiel gebracht werden, wie etwa von der Philosophin Ingrid Robeyns, die mit ihrem „Limitarismus“ zehn Millionen Euro als gesellschaftlich verträgliche Obergrenze von Vermögen ansieht. Diskussionen über Formen eines solchen Limitarismus werden reiche Gesellschaften wohl begleiten. Ein plausibler Begriff von „nationaler“ Solidarität wäre dazu hilfreich.
Er würde aber bald zu der Frage führen, auf welchen Ebenen man Vermögen steuerlich überhaupt am besten erreicht. Kalifornien „verliert“ gerade Milliardäre an Florida und Texas, weil es von ihnen höhere Beiträge zu den Gemeinschaftskosten erwartet. Europa „verliert“ Reiche, die sich nach Dubai absetzen. Zucman ist nicht blind für diese Prozesse, er bedenkt sie mit. Trotzdem wirkt sein Modell einer Reichensteuer wie ein kleiner Wurf. Zumindest gemessen an Hoffnungen mancher Teile der Linken, sofern die nicht sogar schon Phantasien von der großen Enteignung nachhängen.
Gabriel Zucman: „Reichensteuer“. Aber richtig! Aus dem Französischen von Ulrike Bischoff. Suhrkamp Verlag, Berlin 2026. 63 S., br., 12,– €.
