
In Europa dürfte vielen nicht oder nicht mehr klar sein, wie stark der aus Alabama stammende Sänger und Komponist Lionel Richie die Popwelt über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet hat. Zuerst mit der Gruppe The Commodores, dann unter seinem Namen. Ein paar Hits fallen wohl den meisten ein, weil das Formatradio nie aufgehört hat, die Achtzigerjahre in Dauerschleife zu spielen: die Powerballade „Hello“, der afrikanisierende Partysong „All Night Long“, oder auch „Dancing on the Ceiling“, das heute zumindest in den ersten dreißig Sekunden wie eine Bruce-Springsteen-Kopie der mittleren Achtziger klingt – samt dem Schrei kurz vor der Strophe.
Richie hat diese Songs alle selbst geschrieben und Dutzende Hits mehr. Von diesen geballten Urheberrechten – wäre nicht einiges in Scheidungen geflossen – könnte man sich heute ein soziales Netzwerk und eine Rakete kaufen. Drei bis heute laufende Hits sind schon mehr, als die meisten haben, aber Richies Songkatalog verzeichnet noch viele andere sichere Anlagen. In den USA ist dieses Kapital sichtbarer als in Europa, er ist ein amerikanischer Popgigant und war es schon früh über Rassengrenzen hinweg. Allerdings führte diese Position auch zu Problemen.
Balladensänger des gesellschaftlichen Ausgleichs
Um Lionel Richie neu zu sehen, muss man einiges aushalten auf den 500 Seiten der von gleich fünf Übersetzern erstellten deutschen Version von „Truly“, wie die von Mim Eichler Rivas mitverfasste Autobiographie auch auf Deutsch heißt (und die weder auf dem Cover noch auf den ersten Seiten genannt wird). Es gibt einige Zeitsprünge, erstaunliche Lücken, eine oft kumpelhafte Ansprache der Leserschaft und die eine oder andere banale Lebenshilfe eines Mannes mit rund 100 Millionen verkauften physischen Tonträgern. Eines Mannes, der zu viel gearbeitet und die Warnsignale von Körper und Geist zu wenig ernst genommen hat – bis zu seinem Zusammenbruch Ende der Achtzigerjahre. Aber wen dieser Superstar-Habitus nicht zu sehr stört und wer die Glacéhandschuhe des literarischen Geschmacks auszieht, erfährt dann doch viel über Pop im 20. Jahrhundert und auch über die einzigartige Rolle, die Richie darin lange Zeit spielte.
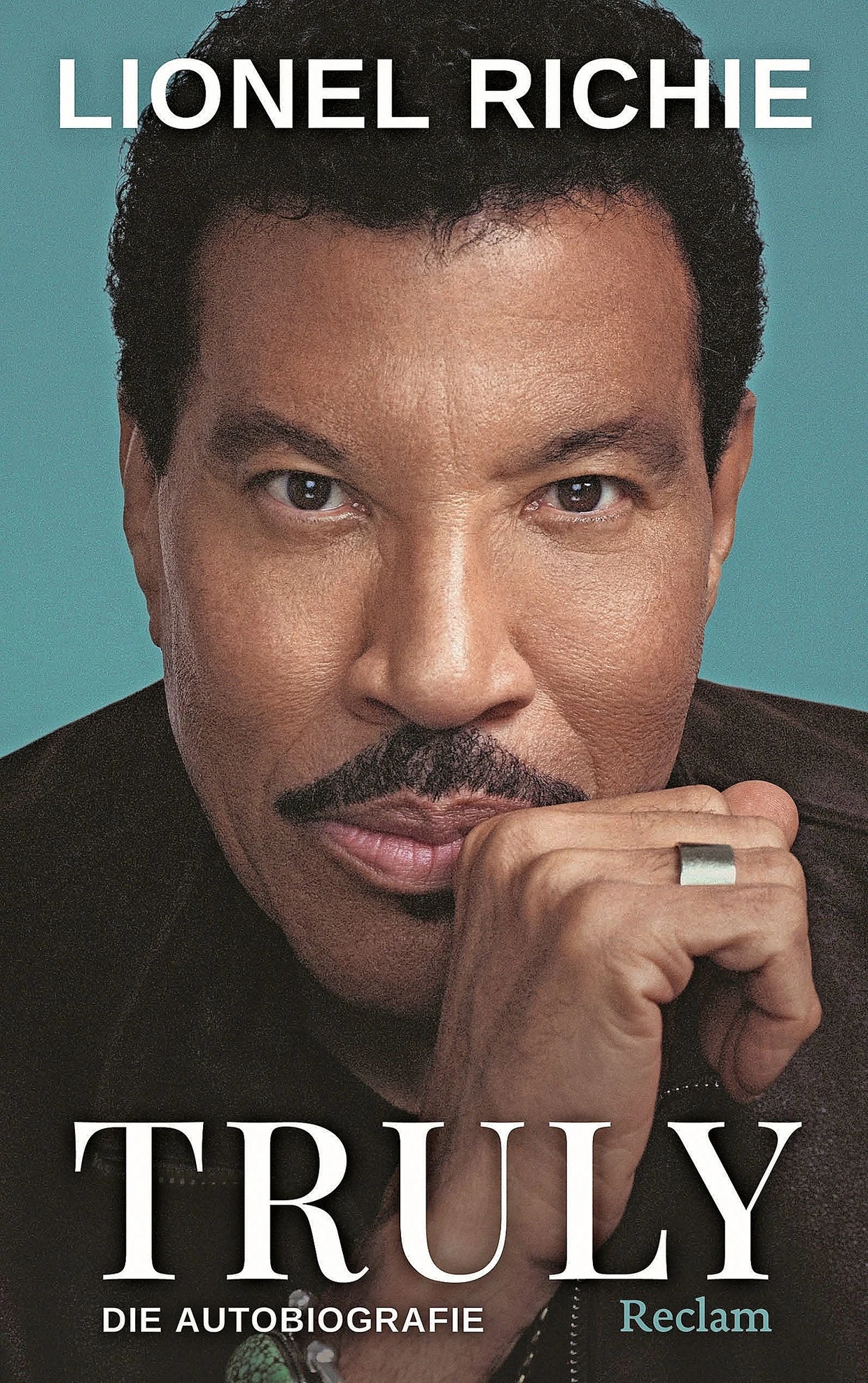
Man mag Richie als Balladensänger des gesellschaftlichen Ausgleichs in Erinnerung halten und nicht als politischen Kämpfer des Pop. Er ist auf dem Gelände einer Universität in Alabama aufgewachsen, seine Familie gehörte zur schwarzen Mittelschicht, aber in einem auch in den Fünfzigern noch faktisch segregierten Staat. Als Student spielte er als Mitglied der Commodores in den Sommermonaten in Harlem, New York City, wo das schwarze Selbstbewusstsein in den späten Sechzigern ausgeprägter, lustvoller und kämpferischer war.
Das ist zum einen lustig und abenteuerlich zu lesen wie jeder Weg aus der Provinz in die Metropole, gefolgt vom gar nicht einmal so kometenhaften, sondern eher langsamen Aufstieg bei der Plattenfirma Motown, die dabei war, aus Detroit nach Los Angeles zu ziehen. Und es ist gleichzeitig erschütternd, daran erinnert zu werden, wie noch in den Achtzigern die berühmtesten TV-Figuren in den USA wie Barbara Walters mit dem Superstar Richie im heimischen Alabama eine Ghettogeschichte erzählen wollten, weil man das mit Schwarzen halt so machte.
Wichtige Freund- und Seilschaften
Richie erzählt recht unaufgeregt von Rassismus, etwa in der Zeit, als nicht nur das damals neue Musikfernsehen an der Rassentrennung festhielt und keine Schwarzen zeigte, bis Prince, Michael Jackson und eben Lionel Richie mit „All Night Long“ doch ins Programm kamen. Doch in den Siebzigern standen die ersten erfolgreichen Songs von Richie wie etwa „Easy“ (1977) auch von schwarzer Seite in der Kritik, weil sie im weißen Mainstream-Radio so erfolgreich waren und für viele somit nicht mehr schwarz genug. Verwirrende Zeiten, weil kurz darauf seine Band The Commodores in Deutschland ausgebuht wurde, als sie im Vorprogramm der Rockband Queen auftrat, weil sie wiederum nicht rockig genug war. Die Lösung: Der Gitarrist spielte die wütende Version der US-Nationalhymne wie einst Jimi Hendrix, was die Menge sofort beruhigte. Wer die Grenzen überquert, stößt auf beiden Seiten auf Widerstände.
Vielleicht sind es diese schmerzlichen Erfahrungen, die den in seiner Musik sonst völlig unpolitischen Richie dazu bewogen haben, nun doch ausgiebiger über das Thema zu berichten und so ein differenziertes Bild der alten Musikindustrie zu zeigen. Interessant zu sehen, dass auch oder gerade auf Richies Berühmtheitslevel Freund- und Seilschaften wichtig waren, um das Business zu überleben, etwa mit Sammy Davis Jr., dem stets um gleiche Bürgerrechte bemühten Frank Sinatra, mit Motowns Top-Songschreiber Norman Whitfield oder auch mit dem Produzenten Quincy Jones. Letzterer verantwortete nicht nur Michael Jacksons „Thriller“, sondern auch den Wohltätigkeitssong „We Are The World“, den Richie mit Jackson schrieb und der vor dem Streamingzeitalter die meistverkaufte Single war.
Erst Anfang des vergangenen Jahres nahm Netflix eine Dokumentation über „We Are The World“ ins Programm; Richie beschreibt das Projekt im Buch noch einmal in allen Details. Diese geballte Star Power von Stevie Wonder über Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper und viele mehr lässt er sich nicht entgehen. Michael Jackson kommt immer wieder vor, weil die Commodores mit den Jackson 5 bereits in den frühen Siebzigern auf Tournee waren und Richie es so aussehen lässt, als wären er und Michael die besten Freunde geworden.
Kein Wort zu Michael Jackson
Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass auf 500 Seiten und bei mehreren Dutzend Nennungen kein Wort über den mutmaßlichen Täter Michael Jackson vorkommt; noch nicht einmal die Prozesse werden genannt, in denen eine Jury ihn freisprach (nach seinem Tod erhoben zwei Männer im Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ schwere Vorwürfe gegen Jackson wegen Kindesmissbrauchs). Wie auch immer man dazu steht: Das Verschweigen dieser Geschichte wirkt irritierend, ja verstörend, wenn an ihrer Stelle viele knuffige Beschreibungen des ein bisschen schrägen, aber niedlichen Stars stehen.
Wenn ein Buch schon „Truly“ heißt, sind solche Riesenlücken so seltsam wie auch die kleineren, etwa dass Richie den größten Hit seiner Ex-Band nicht erwähnt, weil „Nightshift“ kurz nach seinem Abgang aufgenommen wurde. Über seine Zeit bei der Casting-Show „American Idol“ steht so gut wie nichts im Buch und wenig über seine Tochter Nicole, die mit Paris Hilton lange den amerikanischen Boulevard beschäftigt hat.
Umso freimütiger erzählt Richie manchmal von den exzentrischen Verhaltensweisen von Superreichen, etwa einem Ölbaron, der am Tisch des Country-Stars Kenny Rogers nicht mit dem Essen beginnen will, bis Richie persönlich erscheint, worauf sich der nette Star dann sofort ins (deutsche) Luxusauto setzt.
Lionel Richie: „Truly“. Die Autobiografie. Aus dem Englischen von H. Dedekind, K. Dürr, K. Hald, H. Lutosch und S. Reinhardus. Reclam Verlag, Ditzingen 2025. 512 S., Abb., geb., 38,– €.
