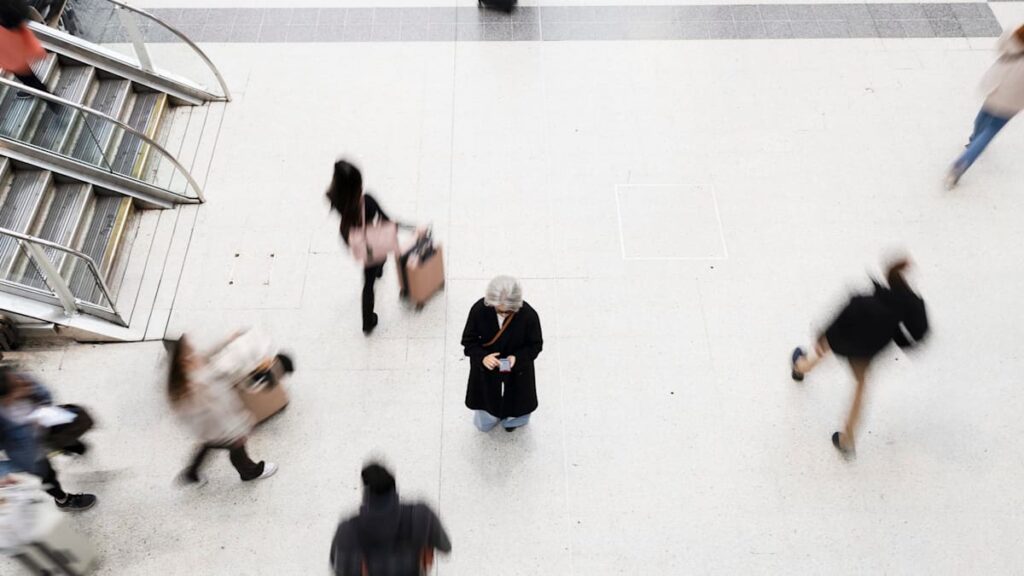
Nach Berlin bekommt nun auch NRW ein Gesetz gegen Diskriminierung durch Landesbedienstete. Was folgt daraus? Eine Klagewelle? Dauerstreit in Behörden? Oder sind die Sorgen übertrieben?
Unverhüllt reckte die Dame ihre Oberweite der Sonne entgegen – auf einem Berliner Kinderspielplatz. Als Ordnungshüter dies entdeckten, forderten sie die Frau auf, ihre Brüste wieder zu bekleiden. Das empfand die Dame als diskriminierend, weil ihr Freund ebenfalls seinen Oberkörper gelüftet hatte und nicht aufgefordert wurde, diesen zu bekleiden. Sie verklagte die Stadt und berief sich auf das damals in Berlin gerade eingeführte Antidiskriminierungsgesetz, das Diskriminierungen durch den Staat ahndet. Sie bekam Recht und 750 Euro Schadenersatz. Ihr Fall sorgte sogar dafür, dass ein Berliner Gericht entschied, auch an anderer Stelle – in städtischen Bädern – existiere ein Oben-ohne-Anspruch.
Grenzenloses Desinteresse der CDU – Eifer bei den Grünen
Solch ein Antidiskriminierungsgesetz wird nach Berlin bald auch NRW beschließen. Der Gesetzentwurf wurde jüngst vorgestellt, im Frühjahr soll er im Parlament eingebracht werden. Dadurch soll Diskriminierung in Schulen, Polizei und anderen Landesbehörden bekämpft, das Prozessieren für Betroffene erleichtert und eine Lücke geschlossen werden: Das bundesweit geltende Antidiskriminierungsgesetz zielt nämlich nur auf Vorfälle im privaten, nicht im staatlichen Bereich.
Ein Gesetz, das Oberweiten-Lüfterinnen auf Kinderspielplätzen unterstützt – diese Vorstellung dürfte manchen Bürgerlichen eine Gänsehaut über den Rücken jagen. Umso erstaunlicher, dass die CDU in NRW dieses Anliegen ihres grünen Koalitionspartners anstandslos durchgewinkt hat. Ja, mehr noch: Die CDU ist schlicht desinteressiert an dem Thema. Das bestätigen Grünen-Politiker in Hintergrund-Runden gegenüber WELT. Dieses Desinteresse belegt auch ein weiterer Umstand: In der CDU-Landtagsfraktion gibt es selbst jetzt, da der Gesetzentwurf vorliegt, laut einem Sprecher keinen einzigen Experten für das Thema – während die Grünen schon 2022 begannen, das Gesetz vorzubereiten.
Ist das schon „Racial Profiling“?
Wie erklärt sich die christdemokratische Zurückhaltung? Zum einen damit, dass es natürlich um viel mehr geht als gelüftete Oberweiten. So hat der grüne Kampf gegen staatliche Diskriminierung auch allseits begrüßte Effekte. In Berlin wurde durch das Gesetz zum Beispiel Behinderten ein barrierefreier Zugang zu Behörden erleichtert. Lange geforderte Rampen für Rollstühle und Rollatoren wurden plötzlich gebaut. Zum anderen sind die Folgen des Gesetzes in vielerlei Hinsicht noch unabsehbar. Es dürfte so manche offene Debatte über vielleicht, vielleicht aber auch nicht diskriminierende Verhaltensweisen auslösen. In Berlin wurden mehrfach Polizeieinsätze unter die Lupe genommen und diskutiert, bei denen Beamte bevorzugt Menschen mit Migrationsgeschichte kontrollierten.
Ob das den Sachverhalt des diskriminierenden „Racial Profiling“ erfüllt, ist nicht immer klar. Diese Praxis kann grob diskriminieren, wenn ohne Grund unter vielen Passanten ausschließlich ein Schwarzer um seine Papiere gebeten wird. Der geschärfte Blick für Menschen mit einer bestimmten Migrationsgeschichte kann aber auch sachgemäß sein, wenn Polizisten Drogendealer in einem Viertel suchen, in dem eine Gruppe mit einem bestimmten Zuwanderungshintergrund das Geschäft dominiert (wie das zum Beispiel die Polizei für einige Drogenszenen Kölns bestätigt).
Mühe und Misstrauen für die Polizei?
Derlei Debatten könnten bei Landesbediensteten zu Verhaltensunsicherheit führen, mahnten Polizeigewerkschaften einst. Auch Berlins heutiger Regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigte vor der vergangenen Berlin-Wahl noch an, im Falle eines Wahlsieges werde er das Antidiskriminierungsgesetz wieder abschaffen, weil es der Polizei gegenüber pauschales Misstrauen ausdrücke. Gönül Eglence, Migrations- und Teilhabe-Expertin der Grünen in NRW, hält jedoch dagegen, „gerade durch solche kurzzeitigen Debatten“ stelle „sich doch Rechts- und Verhaltenssicherheit ein“.
Ein anderes Streitthema sind Beförderungen oder Weiterbildungen im öffentlichen Dienst. Bleiben zum Beispiel Senioren oder Schwangere dabei unberücksichtigt, werden Arbeitgeber künftig noch gründlicher darlegen müssen, dass ihre Entscheidung nicht von Alter oder Schwangerschaft des Abgelehnten abhängig war oder dass es sachlich gerechtfertigt war, Alter oder Schwangerschaft als Ausschlussgrund zu werten.
Denn auch das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) erkennt natürlich an, dass Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein kann. Das geplante LADG erleichtert nur das Klagen in solchen Fällen. Betroffene müssen keine Beweise, sondern Indizien für eine Diskriminierung vorlegen. Gelingt das, muss die beschuldigte Behörde nachweisen, dass sie nicht diskriminiert.
Verbände übernehmen Kosten der Klagen – manchmal
Zudem sieht das LADG Schmerzensgeld und Entschädigung vor. Es gibt also Klage-Anreize (die Höhe der Entschädigungen liegt in Berlin indes meist unter 1000 Euro, für NRW ist sie noch nicht festgelegt). Und schließlich können auf Diskriminierung spezialisierte Verbände in NRW bald Klagen übernehmen. Sie befreien die Kläger von Kosten – sofern sich die Betroffenen an einen solchen Verband wenden und dieser die Klage übernehmen will. Doch diese Aussicht auf mehr Rechtsstreitereien wegen umstrittener Diskriminierungsvorwürfe bringt die NRW-CDU nicht aus der Ruhe.
Wohl auch, weil die bisherige Erfahrung besänftigt. In Berlin kam es nach 2020 zu keiner Klageflut. Dabei erhielten dortige Verbände im Vergleich zu NRW sogar weiter reichende Klage-Möglichkeiten. Trotzdem gingen bei den für Opferberatung zuständigen Ombudsstellen seit 2020 nur 1785 Diskriminierungsbeschwerden ein (und gut 2000 Beratungsanfragen).
Klagen selten, Erziehungsmaßnahmen oft
Noch bemerkenswerter: Diese Beschwerden führten bis 2024 erst zu sechs Gerichtsverfahren. „Das sollte niemanden verwundern“, meint die Grüne Eglence, „weil es Antidiskriminierungsgesetzen nicht darum geht, Streit vom Zaun zu brechen, sondern Diskriminierung zu beenden. Einer rassistisch gemobbten Mitarbeiterin geht es ja nicht um Schadenersatz. In erster Linie will sie, dass die Diskriminierung aufhört.“
Obendrein reicht auch künftig nicht der subjektive Eindruck aus, damit eine Beschwerde anerkannt wird; es müssen schon Indizien für eine Diskriminierung vorliegen. Und: Rechtsstreitigkeiten kosten Geld. Diese Kosten übernimmt aber nur selten ein Verband – nämlich dann, wenn ihm der Fall wegweisend scheint. Denn auch Verbände haben nur begrenzte Ressourcen. Häufiger als Klagen dürfte es künftig klärende Gespräche zwischen Kollegen geben oder Fortbildungen etwa zur Frage, wie man mit Minderheiten kommuniziert. Wer diskriminiert, wird also erzogen. Wie sich diese Maxime auf die Atmosphäre in der Berliner Verwaltung ausgewirkt hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Bilanzierende Studien gibt es dazu nicht.
Droht der Union ein böses Erwachen?
Die Entspanntheit der CDU könnte sich jedoch rächen. Zum einen hat sie in den Koalitionsverhandlungen 2022 durchgesetzt, dass in NRW (anders als in Berlin) keine Ombudsstellen geschaffen werden, an die sich Betroffene wenden können. Es wird also kein zusätzliches Personal eingestellt für die Beratung von Diskriminierungsopfern. Das spart, wie man in der CDU glaubt, Geld. Die Grünen sind aber überzeugt, in Berlin hätten insbesondere diese Ombudsstellen eine Klageflut verhindert, weil sie sich um außergerichtliche Lösungen bemühten. Träfe dies zu, könnten fehlende Ombudsstellen die Zahl der Klagen in NRW hochtreiben – und die CDU böse überraschen.
Zum anderen bestand die Union in den Koalitionsverhandlungen darauf, das LADG nur auf Landesbehörden anzuwenden, nicht auf Kommunen. Hintergedanke: Wenn auch in allen 427 kommunalen Verwaltungseinheiten des Landes mit rund 394.000 Beschäftigten und Millionen Bürgerkontakten leichter geklagt werden könnte, würde dies womöglich doch eine Klagewelle auslösen. Diese Ausklammerung der Kommunen wollen einige NGOs aber nicht akzeptieren, wie WELT exklusiv erfuhr. Bei einem Treffen von Antidiskriminierungsinitiativen im Landtag kündigten diese an, dagegen zu prozessieren, sollte das Gesetz nicht auf Kommunen angewendet werden. Ob das die CDU hellhörig macht?

