
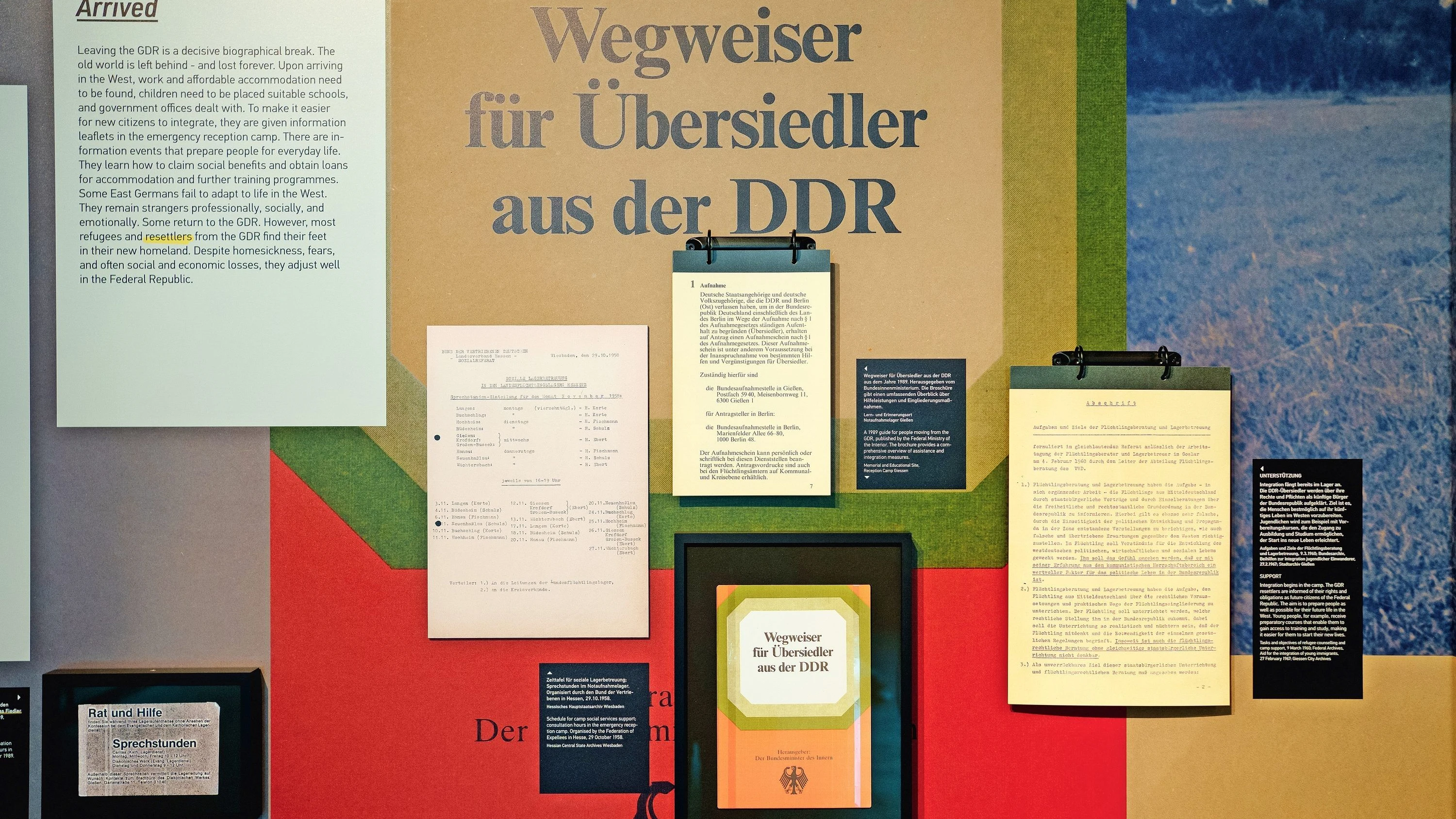
Eines Tages reicht es dem jungen Arzt. Eine Sekretärin streicht seinen Kollegen und ihm in ihrer Poliklinik im Raum Cottbus auch noch die letzte medizinische Publikation aus dem Westen. Begründung: Für die Schrift reichten die Devisen nicht, die Mediziner müssten eben ohne sie auskommen. „Damit war unsere letzte Verbindung in den Westen abgeschnitten“ – und damit zum medizinischen Fortschritt jenseits der DDR-Grenze. In jenen Tagen in den Achtzigerjahren reift in ihm ein jahrelang in den Hintergrund geratener Gedanke: rübermachen in die Bundesrepublik.
Der junge Arzt hat Verwandtschaft in der Nähe von Bad Pyrmont, jenen Teil der Familie, der auf der Flucht aus Schlesien nicht in der DDR sesshaft geworden war. Sie schickt ihm eine Einladung zu einem 80. Geburtstag. Der Mediziner darf reisen, seine als Zahnärztin tätige Frau und die gemeinsamen Kinder bleiben in Ostdeutschland. Er wird also schon wiederkommen. Den 80. Geburtstag gab es 1987 wirklich, wie der Mann vier Jahrzehnte später am Rande des Erzählcafés im ehemaligen Notaufnahmelager Gießen berichtet, das er einst durchlaufen hat. Die Altersjubilarin habe zwar nicht so recht gewusst, um wen es sich in Gestalt des Gastes von drüben gehandelt habe. Für ihn aber bedeutete die Einladung eine Eintrittskarte in eine neue Welt. Er ging nicht wieder zurück.
„Paris war uns immer näher als Berlin“
Seine Frau bekam deshalb bald neugierigen Besuch, wie sie an einem Tisch mit weiteren DDR-Flüchtlingen und anderen Gästen erzählt. Eingeladen worden ist die Runde vom Team des interaktiven Museums Notaufnahmelager und der in Weimar ansässigen Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte. An diesem Nachmittag soll es um Fluchterfahrungen und die Eingewöhnung in der neuen Heimat bis etwa Mitte der Neunzigerjahre gehen. Mit am Tisch sitzen auch Männer und Frauen, die diese Zeit im Westen als Kinder erlebt haben oder noch gar nicht auf der Welt waren. Eine Frau zum Beispiel berichtet, sie sei nahe der französischen Grenze aufgewachsen und am Tag des Mauerfalls, dem 9. November 1989, auch dort gewesen. „Paris war uns immer näher als Berlin.“
Für die junge Zahnärztin aus dem Raum Cottbus galt im Alltag das Umgekehrte, aber nicht unbedingt im Geiste. Der Drang zur Selbständigkeit habe ihr schon immer innegewohnt. „Ich fand es schrecklich, dass man in der DDR nicht aus freien Stücken selbständig sein durfte“, sagt sie. Doch bevor sie mit dem Nachwuchs ihrem Mann folgen konnte, musste sie sich vor allem in einem üben: „Ich habe gelogen, gelogen und gelogen.“
Ob sie von der Volkspolizei oder der Staatssicherheit verhört worden sei? „Es gab Gespräche“, sagt die Wahl-Wiesbadenerin. Sie habe den Aufenthaltsort ihres Mannes zwar gewusst, es aber niemandem gesagt. Einmal seien ihre beiden Töchter im Kinderzimmer von einer Frau befragt worden, während sie mit dem männlichen Teil des ungebetenen Besuchs im Wohnzimmer habe sitzen müssen. Wenn die Kleinen etwas gewusst und sich verplappert hätten – „ich wäre aufgeflogen“. Ihr sei angeboten worden, in eine andere Stadt zu ziehen. „Sie sagten mir sogar: ,Wir besorgen Ihnen einen anderen Mann.‘“
Dessen ungeachtet habe der neugierige Besuch wissen wollen, wie ihr Mann zur Rückkehr bewegt werden könnte. Sie habe geantwortet: „,Lassen Sie mich fahren, ich suche ihn und probiere es.‘ Das haben sie aber nicht gemacht“, erinnert sie sich und lächelt darüber.
Für Kopfschütteln sorgt die Erinnerung an den Besuch bei der Zahnärztekammer nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik wenige Monate vor dem Mauerfall, wo sie ihre Approbation als Zahnärztin anerkennen lassen wollte. Ihr Ansprechpartner habe aber nicht mit ihr gesprochen, vielmehr habe er ihren Mann befragt, wann sie geboren sei und wann sie ihr Examen gemacht habe. „Das war so in den Amtsstuben im Westen: Ich rede nur mit dem Mann.“ Das wiederum habe sie aus der DDR nicht gekannt.
„Wir wussten, wir müssten uns anstrengen“
Sie fasste schließlich als Zahnärztin nahe Bad Pyrmont neu Fuß, wo ihr Mann nach einem Zwischenspiel im Gießener Raum als Arzt arbeitete. Dort habe es nur eine andere Berufskollegin gegeben – „auch die war aus dem Osten“. Ein Vierteljahr nach Eröffnung ihrer Praxis habe sie ihre Zahnarztkollegen eingeladen. „Nicht einer ist gekommen“, sagt sie.
Ob sie denn von solchen Enttäuschungen abgesehen keine grundsätzlichen Schwierigkeiten gehabt hätten, sich im Westen einzugewöhnen, bedeutete dies doch statt in einem vormundschaftlichen Staat in einem freiheitlichen Land zu leben, das viel Eigeninitiative verlange? „Wir wussten, wir müssten uns anstrengen“, sagt die Wahl-Wiesbadenerin. Sie habe überlegt, ob sie konkurrenzfähig sei und wo sie womöglich Nachholbedarf habe. Aber mit dem DDR-Modell, nach dem der Staat für einen alles regele, hätten sie ja schon vorher nichts am Hut gehabt. „Wenn einer etwas selbst regeln wollte, fiel er aus der Masse heraus. Dann ist es problematisch geworden“, erinnert sich ihr Mann.
Diese Mentalität sei auf dem Gebiet der ehemaligen DDR heute noch tragend. Denn den Osten Deutschlands hätten viele Menschen nach der Wende verlassen, die etwas wagen wollten oder mussten. „Die Verbliebenen fallen hinten runter, das führt bei manchen zu braunen Gedanken“, meint er.
