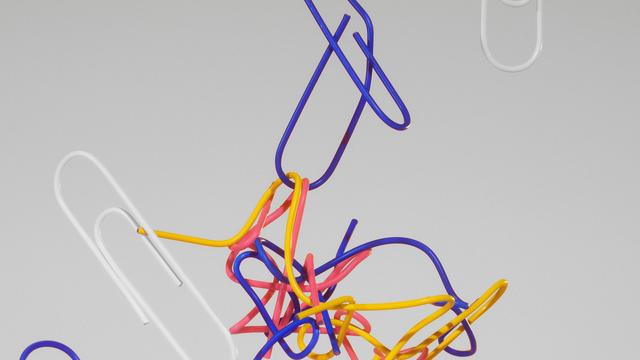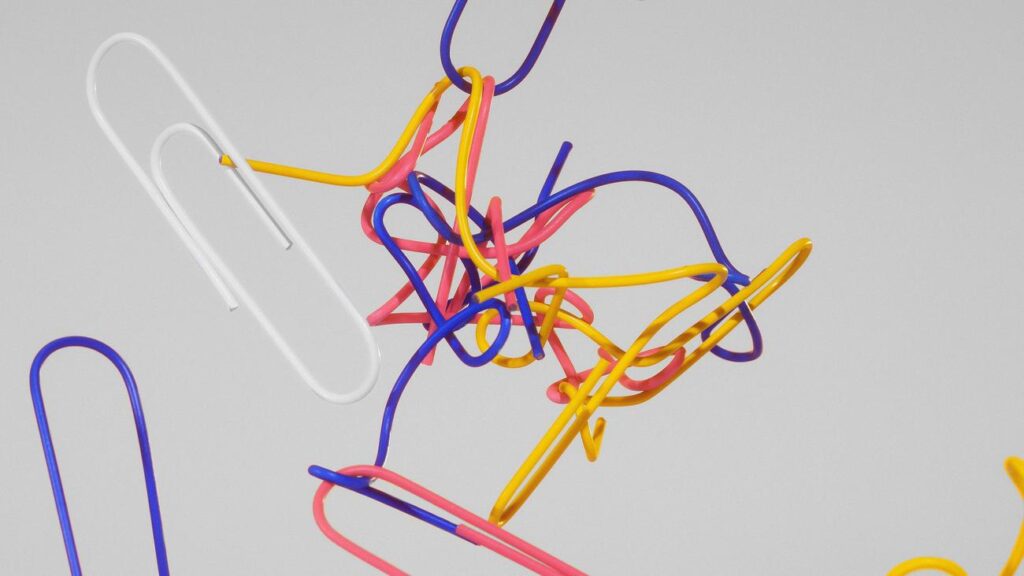
Nicht
nur in der Union streiten sich die Generationen über die Rente. Jüngere Menschen haben das Vertrauen in die Rente verloren. „Dabei
ist das gesetzliche System besser als sein Ruf“, sagt Patricia Frericks.
Sie muss es wissen: Die Professorin für Soziologie und Ökonomie sozialer Dienste und Einrichtungen an der Universität Kassel erforscht seit 20 Jahren europäische Rentensysteme und leitet gegenwärtig eine Studie zur Rente der Generation Y (die auch Millenials genannt wird). Die Studie wischt einen großen Teil der Kritik der jungen CDU- und CSU-Abgeordneten weg und belegt, dass das gesetzliche System für die junge Generation
wirkt – und die Mütterrente besonders für die jüngeren Frauen wichtig ist.
In Deutschland
sammeln alle, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, jährlich Rentenpunkte. Ein Punkt entspricht aktuell 40,79 Euro. Mütter bekommen
zusätzlich drei Punkte pro Kind, die sogenannte Mütterrente, mit der
Erziehungsleistungen wie Erwerbsarbeit bei der Rente bewertet werden. Die Wirkung der Mütterrente kann je nach Lebenslauf ganz unterschiedlich für die spätere Rente sein. Das zeigen die Daten aus Frericks Studie. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie untersucht, wie sich die Mütterrente für die Frauen der Generation Y auswirkt.
Eine Frau, die ab 22 im <span style=“color:white;background-color:#F66809;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Minijob</span> arbeitet, bekommt ohne Kinder durchschnittlich nur etwa 0,13 Rentenpunkte pro Jahr.
Die zweite Frau hat eine abgeschlossene <span style=“color:white;background-color:#0387A0;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Ausbildung</span>. In Vollzeit verdient sie so viel, dass sie im Schnitt 0,8 Rentenpunkte pro Jahr sammelt.
Die dritte Frau hat einen <span style=“color:white;background-color:#269661;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Masterabschluss</span>. Durch ihr längeres Studium steigt sie erst mit 26 Jahren ins Berufsleben ein, erhält aufgrund ihres höheren Einkommens dafür aber durchschnittlich 1,08 Punkte pro Jahr bis zur Rente.
Nehmen wir an, die drei Frauen bekommen nach rund sieben Berufsjahren ihr erstes Kind. Zwei von ihnen gehen in Elternzeit und bekommen keine Rentenpunkte durch Erwerbsarbeit. Die Mütterrente gleicht das aus. Alle drei erhalten automatisch einen Rentenpunkt pro Jahr, bis das Kind drei Jahre alt ist, unabhängig vom Einkommen.
Nach einem zweiten Kind arbeiten zwei der Frauen in Teilzeit (50 Prozent), die Minijobberin bleibt in der geringfügigen Beschäftigung. Besonders bei der gut ausgebildeten Frau mit <span style=“color:white;background-color:#269661;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Masterabschluss</span> ist die Rentenlücke durch Teilzeit nun aber spürbar. Im Vergleich mit einer kinderlosen Akademikerin, die in Vollzeit arbeitet, erwirbt sie nun viel weniger Rentenpunkte. Die Frau im <span style=“color:white;background-color:#F66809;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Minijob</span> steht hingegen besser da als nur mit Rentenpunkten aus dem Minijob.
Sobald das jüngste Kind zehn ist, arbeiten zwei Frauen wieder Vollzeit, die Minijobberin bleibt bei der geringfügigen Beschäftigung. Doch die Jahre in Teilzeit wirken nach. Je höher das Gehalt, desto stärker schlägt Teilzeit auf die Rentenpunkte durch. Die Frau mit <span style=“color:white;background-color:#269661;padding:4px;border-radius:5px;font-weight:bold“>Masterabschluss</span> erreicht deshalb nicht mehr die Werte kinderloser Akademikerinnen.
Die deutsche Rentenversicherung sei ein im Kern soziales und solidarisches System. Es bewerte nicht nur nach Marktmechanismen, also Einkommen, Beiträgen und Beitragsjahren, sondern stabilisiere die Werte der Beiträge innerhalb und zwischen den Generationen und berücksichtige auch Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Sorgearbeit – Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen –, sagt Frericks. Ihre Studie belegt: Einen Teil der Verluste bei der Rente, die durch Carearbeit entstehen, gleicht das System für die Frauen aus. Bei den jüngeren Frauen mit geringen
Einkommen werden die Einbußen sogar überkompensiert – und das hilft insgesamt, die Rentenlücke zu verkleinern.
Allerdings gibt es für Frauen nicht nur eine Rentenlücke. „In den letzten 20 Jahren hat es zahlreiche Eingriffe am Rentensystem gegeben. Das Rentenniveau wurde drastisch abgesenkt. Dadurch entsteht die erste Lücke, die die Menschen über private oder betriebliche Vorsorge füllen sollen“, erklärt Frericks. Und dann ist da noch die Lücke zwischen den Geschlechtern, die mit dem vorherrschenden Familienmodell und Arbeitsteilung in der Familie, aber auch mit der Berufswahl und individuellem Verhalten zu erklären ist. Bei den heutigen Rentnerinnen und Rentnern ist sie groß: Frauen bekommen im Schnitt 39,4 Prozent weniger gesetzliche Rente als Männer.
Das liegt auch daran, dass die heutigen Rentnerinnen erst seit 2014 eine
Mütterrente erhalten. Und erst ab 2026 wird die Erziehungsleistung der alten Frauen wie die der jüngeren Frauen bei der Rente bewertet. Für Frericks ist das kein teures Rentengeschenk an die heutigen Rentnerinnen, sondern eine „konsequente Antwort auf die beschränkten Möglichkeiten, die diese Frauen damals hatten. Schließlich gibt es ein Recht auf Kleinkindbetreuung erst für jüngere Generationen.“
Bei der Generation Y beginnen die Kurven, sich mit Ende zwanzig auseinanderzufächern
– genau in dem Lebensalter, in dem viele Frauen der Generation Y ihre
Familie gründen. Frericks konnte einen Rentenabstand von 32,7 Prozent zu den Männern ermitteln. Aber durch die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten wird diese Lücke um fast zehn Prozentpunkte auf 23,2 Prozent gesenkt. In einigen Gruppen haben die Frauen durch die Mütterrente sogar zwischenzeitlich höhere Rentenansprüche als die Männer – bleiben sie jedoch in Teilzeit und die Männer arbeiten in Vollzeit weiter und sorgen außerdem noch privat und betrieblich vor, was Frauen mit Teilzeitlöhnen viel schwerer gelingt, vergrößert sich der Gender-Pension-Gap auch bei der jungen Generation wieder.
Das Fazit der Forscherinnen lautet dennoch: Das System sichert heute Frauen in der kritischen Phase der Familiengründung aktiv ab. Wichtig bleibt aber, dass Mütter spätestens, wenn die Kinder zur Schule gehen, wieder in Vollzeit arbeiten. Oder sich die Teilzeitarbeit paritätischer mit den Männern teilen. Denn die arbeiten viel seltener in Teilzeit als Frauen, wie unsere Grafik zeigt.
Die Mütterrente kann also die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen schließen, wie die Grafik zeigt. Nimmt man theoretisch an, es gäbe diese Punkte nicht, hätten Mütter deutlich weniger Rentenpunkte. Das zeigt die unterste, rote Linie.
Um das Rentensystem fair und zukunftsfähig zu machen, fordert die
Rentenexpertin, dass endlich „Schluss sein muss damit, die öffentliche
Rente schlechtzumachen“. Es sei nicht nur das Verhältnis von Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden, das die Finanzierbarkeit von Renten bestimme. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass eine funktionierende Wirtschaft vieles ausgleiche. Man müsse sich, sagt Frericks, aber grundsätzlich fragen – und mit den Jüngeren diskutieren –, was das gesetzliche Rentensystem leisten soll. Spätestens seit der Wende werde viel durch Steuerzuschüsse abgefangen. Gleichzeitig wurden Marktkomponenten wie Riester gestärkt und es soll eine Frühstartrente kommen. Auch die Mütterrente wurde eingeführt. Frericks: „Das System wurde also bereits maßgeblich umgebaut.“
Wenn man diese bisherigen Änderungen weiterdenke, könne man zu schlüssigen Lösungen kommen, die auch die Jüngeren überzeugten. So könnte am Ende dieser Umbauphase eine steuerfinanzierte Basisrente, steuerfinanzierte Rentenanteile für Pflege- und Erziehungszeiten und beitragsfinanzierte Rentenanteile für Erwerbsphasen stehen, ähnlich, wie es in den Niederlanden der Fall ist. „Dort gibt es, anders als bei uns, auch keine Altersinvestitionsfalle, da jeder angelegte Euro die spätere Rente erhöht“, sagt Frericks.
Und für die junge Generation gelte ohnehin: sich schon heute mit der Rente beschäftigen, das System verstehen – und vor allem die
Sorgearbeit partnerschaftlicher aufteilen. Dann hält die gesetzliche
Rente, was sie verspricht – und die Mütterrente tut den Rest.