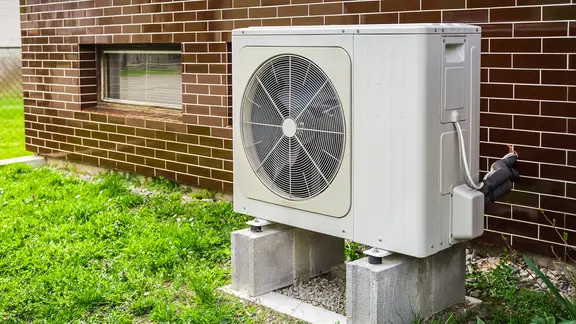AUDIO: Heizen wird teurer: Netzentgelte, Steuern und Umlagen steigen (5 Min)
Stand: 14.10.2025 14:56 Uhr
Temperatur reduzieren, Heizung entlüften, Thermostat tauschen: Einfache Maßnahmen können helfen, beim Heizen den Energieverbrauch und die Kosten zu reduzieren. Tipps für geringere Heizkosten.
Auch wenn Gas und Öl nach der Energiekrise 2022/2023 günstiger geworden sind: Verbraucher müssen sich auf höhere Heizkosten einstellen. Das geht aus dem aktuellen Heizspiegel der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online hervor. Vor allem das Heizen mit Gas wird durchschnittlich 15 Prozent teurer. Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel fallen dann im laufenden Jahr fast 1.200 Euro an, 150 Euro mehr als im Vorjahr.
Als Hauptursachen werden höhere Energiepreise und die niedrigen Temperaturen zu Jahresbeginn genannt. Beim Heizen mit Gas und Öl schlagen vor allem der steigende CO2-Preis und höhere Netzentgelte zu Buche. Co2online geht davon aus, dass die Heizkosten auch in den kommenden Jahren steigen werden, am wenigsten dürften sich die Kosten beim Heizen mit Wärmepumpe erhöhen.
Beim Heizen Sparpotenzial nutzen
Beim Heizen kann man viel Geld sparen und zugleich etwas für den Klimaschutz tun. Denn laut Umweltbundesamt verbraucht die Heizung mehr als zwei Drittel der gesamten Energie in privaten Haushalten. Es besteht also besonders beim Heizen großes Sparpotenzial. Wer etwa die Raumtemperatur um einen Grad senkt, kann Experten zufolge bis zu sechs Prozent Heizkosten sparen.
Wie heize ich meine Wohnung richtig?
Laut Umweltbundesamt sollte die Raumtemperatur im Wohnbereich nicht mehr als 20 Grad betragen, sofern dies als behaglich empfunden wird. In der Küche liegt die Empfehlung bei 18 Grad und im Schlafzimmer bei 17 Grad – immer an das individuelle Empfinden angepasst. Die optimale Temperatur hängt dabei von Alter und Gesundheit der Bewohner ab.
Nicht weniger als 19 Grad in Wohnbereichen empfohlen
Je niedriger die Temperatur in einem Raum ist, desto eher kann sich Schimmel bilden. Daher warnt das Umweltbundesamt davor, die Heizung in der Heizperiode in viel genutzten Wohnungen auf weniger als 16 bis 18 Grad herunterzudrehen. Denn bei diesen Temperaturen steigt das Schimmelrisiko zum Teil massiv, besonders bei alten und schlecht gedämmten Gebäuden. Das wirkt sich negativ auf Gesundheit und Bausubstanz aus. In Räumen, in denen man sich tagsüber dauerhaft aufhält, sollten daher nach Möglichkeit nicht weniger als 19 Grad herrschen.
Richtiges Lüften minimiert Risiko für Schimmelbildung
Um Schimmel vorzubeugen, sollte zudem regelmäßig stoßgelüftet werden. Am schnellsten geht es mit der Querlüftung, bei der Fenster in gegenüberliegenden Zimmern weit geöffnet werden. In den kalten Wintermonaten reichen meist fünf Minuten. Der Luftzug tauscht die feucht-warme Luft schnell aus. Dauerlüften mit gekippten Fenstern verschwendet dagegen viel Energie.
Thermostat mit Zahlen: Welche Stufe für welche Temperatur?
In vielen Haushalten sind noch Thermostate ohne digitale Anzeige der Raumtemperatur verbaut, auf denen sich lediglich Stufen von eins bis fünf per Drehbewegung einstellen lassen. Doch für welche Temperaturen stehen diese Stufen? Und wie lässt sich die Wärme beispielsweise von 21 auf 20 Grad reduzieren? Ist die Heizungsanlange richtig eingestellt, stehen die einzelnen Stufen laut Verbraucherzentrale in etwa für folgende Raumtemperaturen:
- 5: circa 28 Grad
- 4: circa 24 Grad
- 3: circa 20 Grad
- 2: circa 16 Grad
- 1: circa 12 Grad
Die Striche zwischen den Ziffern stellen eine Abstufung der Temperaturen dar. Ein Strich entspricht jeweils ungefähr einem Grad. Wer sich nicht sicher ist, ob die Temperatur stimmt, kann ein Thermometer zu Hilfe nehmen. Auch der Einbau neuer Thermostate kann helfen, die Temperatur besser zu regulieren.
Was Schneeflocke, Stern und Sonne auf der Heizung bedeuten
Das Symbol der Schneeflocke oder des Sterns bildet bei vielen Thermostaten die kälteste Stufe ab. Die Heizung springt auf dieser Stufe in kalten Wintertagen automatisch an, wenn die Temperatur im Raum unter 6 Grad sinkt. Aus gutem Grund: Denn durch eine konstante Temperatur von 6 Grad kann das Wasser in der Heizung auch an kalten Wintertagen nicht einfrieren. Das schützt Rohre und Heizung vor Frostschäden und Eigentümer vor kostenintensiven Reparaturen.
Das Symbol der Sonne kennzeichnet die optimale Temperatur für Räume, in denen sich Bewohner tagsüber aufhalten. Sie ist bei Stufe 3 zu finden und liegt damit bei etwa 20 Grad.
Soll man die Heizung immer anlassen?
Das Symbol des Halbmondes steht für die sogenannte Nachtabsenkung. Die Nachtabsenkung liegt meist zwischen Stufe eins und zwei und damit bei etwa 14 Grad. Die Heizung nachts ganz auszuschalten, ist in den meisten Fällen nicht ratsam. Denn das Wiederaufheizen der kalten Wohnung am Morgen verbraucht sehr viel Energie, was Einsparungen zunichtemachen und sogar mehr Kosten verursachen kann. Die Heizung nachts auf minimal 16 Grad zu senken, kann aber eine gute Lösung sein.
Ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist, hängt stark vom individuellen Zustand und der Dämmung eines Gebäudes ab. Oft lohnt es sich, die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb bedarfsgerecht einstellen zu lassen. Grundsätzlich gilt: Je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto größer sind die Einsparmöglichkeiten durch die Nachtabsenkung der Heizung. Bei gut isolierten Gebäuden ist der Spareffekt hingegen weniger groß. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine gute Gebäudedämmung insgesamt mehr Energie spart, weil schlecht isolierte Gebäude einen hohen Wärmeverlust aufweisen.
Heizung wird auf Stufe fünf nicht schneller warm
Viele Menschen drehen die Heizung in kalten Wohnungen zunächst auf die fünfte Stufe, damit es schneller warm wird. Das ist energetisch betrachtet keine gute Idee. Denn das Thermostat ist nicht mit dem Aufdrehen eines Wasserhahns vergleichbar. Es regelt nur, welche Temperatur am Ende erreicht werden soll und nicht, wie schnell das geht. Wer die Heizung voll aufdreht und anschließend vergisst, sie zurückzudrehen, heizt mehr als gewollt und verbraucht so unnötig Energie.
Heizung entlüften und Wasser nachfüllen
Wenn Heizkörper gluckern und trotz voll geöffnetem Ventil nicht richtig warm werden, hat sich vielleicht Luft darin gesammelt. Diese kann durch das Entlüftungsventil an der Seite des Heizkörpers abgelassen werden: Becher unterhalten, Schraube mit kleiner Zange öffnen und Luft ablassen, bis nur noch Wasser herauskommt. Für viele Heizkörper sind spezielle Entlüftungsschlüssel erforderlich, die in Baumärkten erhältlich sind.
Wurde viel Luft entfernt, muss eventuell Wasser in den Heizkreislauf nachgefüllt werden. Ein Blick auf die Druckanzeige am Kessel oder der Heiztherme zeigt, ob das notwendig ist. Wer sich das regelmäßige Entlüften sparen möchte, kann am Heizkörper spezielle automatische Entlüftungsventile anbringen.
Zugluft vermeiden: Fenster und Türen abdichten
Bei leichtem Luftzug im Raum fühlt sich die Temperatur niedriger an als sie ist. Fenster und Türen sollten daher gut schließen. Mit einer brennenden Kerze, die bei Zugluft flackert, lassen sich undichte Stellen entdecken. Klebedichtungen aus dem Baumarkt sorgen für Abhilfe. Besonders Türen zum Treppenhaus sollten auch nach unten keine Luft hereinlassen. Dichtungen mit Bürstenstreifen sind flexibel und schließen selbst zentimeterbreite Lücken.
Nischen, Heizungsrohre und Fenster selbst dämmen
Häuser aus den 1950er- bis 1970er-Jahren haben meist dünne, schlecht gedämmte Wände. Hier ist es hilfreich, die Heizkörpernischen mit Polystyrolschaum-Platten mit Alu-Beschichtung zu isolieren. Sie reflektieren die Wärme und halten sie so im Zimmer. Das Material aus dem Baumarkt wird einfach an die Wand geklebt. Damit Heizkörper die Wärme optimal in den Raum abgeben können, sollten sie nicht von Vorhängen oder Möbeln verdeckt werden.
In Einfamilienhäusern steht der Heizkessel meist im Keller. Auf dem Weg in die Wohnräume geben die Heizungsrohre unnötig Wärme ab – so geht viel Energie verloren. Dämmende Rohrisolierungen aus dem Baumarkt lassen sich einfach selbst montieren.
Nachts geht viel Wärme durch die Fenster verloren, selbst bei modernen Scheiben mit Doppel- oder Dreifach-Verglasung. Das gilt besonders für große Glasflächen an Balkonen oder Terrassen. Geschlossene Rollos oder Vorhänge können den Wärmeverlust reduzieren.
Heizung regelmäßig warten und modernisieren
Daneben gibt es Maßnahmen, die man einem Fachbetrieb überlassen muss. Dazu gehört es, die Heizungsanlage regelmäßig zu warten und zu reinigen. Dabei lohnt ein Blick auf die Umwälzpumpe. Alte Modelle verbrauchen viel Strom, da sie stets mit voller Last arbeiten. Moderne Pumpen passen ihre Leistung dem Bedarf an und sind daher sparsamer. Gegebenenfalls lohnt ein Austausch.
Bei einem sogenannten hydraulischen Abgleich werden alle Komponenten der Heizungsanlage optimal aufeinander und auf den Wärmebedarf im Haus angepasst. Allerdings kostet diese Einstellung bis zu 1.000 Euro. Auch die Vorlauftemperatur sollte ein Fachbetrieb bedarfsgerecht einstellen.
Anbieterwechsel prüfen
Die Preisunterschiede bei Gas- und Öltarifen können groß sein. Häufig lohnt sich deshalb ein Wechsel des Anbieters. Verbraucher sollten am besten Vergleichsportale nutzen, um sich einen guten Überblick über viele Angebote zu verschaffen und sie direkt miteinander vergleichen zu können. Vor Vertragsabschluss unbedingt über den neuen Anbieter informieren. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, den passenden Tarif zu finden.
Energetische Sanierung und neue Heizung
Höhere Einsparungen lassen sich nur durch größere Investitionen erzielen, beispielsweise durch den Austausch alter Fenster, eine Dämmung des Gebäudes oder den Umstieg auf ein erneuerbares Heizsystem, etwa eine Wärmepumpe. Für diese Maßnahmen stellt der Bund umfangreiche Fördermittel bereit, die im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt sind.
Eine Reform ist geplant, bis dahin gilt: Wird eine neue Heizung eingebaut, muss sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für bestehende Gebäude gilt eine Übergangsfrist. Außerdem gibt es zinsgünstige Kredite für den Heizungstausch sowie Möglichkeiten, die Kosten steuerlich geltend zu machen. Die Details sind in der sogenannten Bundesförderung für effiziente Gebäude zu finden. Die Verbraucherzentrale bietet eine umfangreiche Energieberatung an.