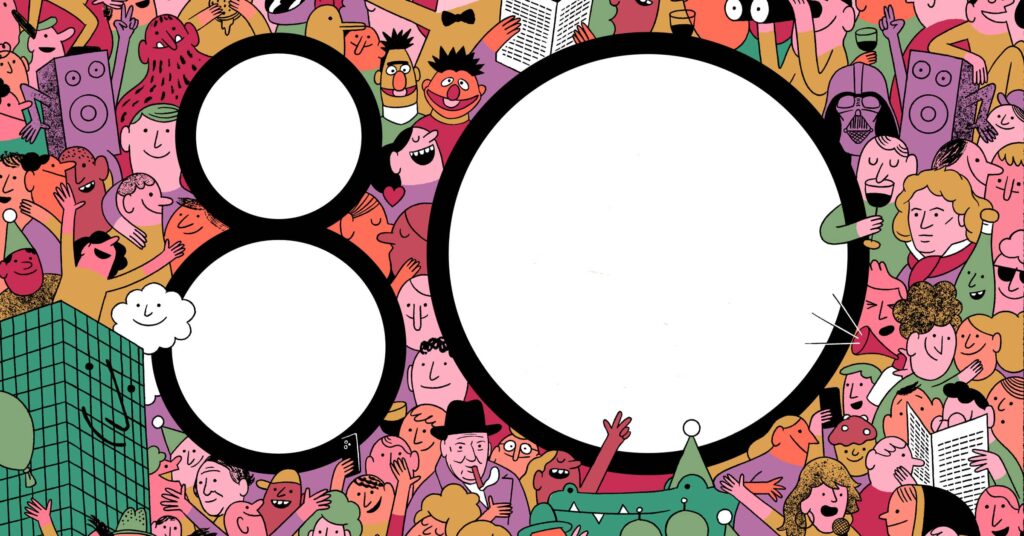
Das größte Kapital, das eine Zeitung haben kann, ist nicht der Anzeigenumsatz oder die Reichweite einzelner Texte oder textähnlicher Dinge im Netz. Das größte Kapital mit den besten Zinsen ist das Vertrauen ihrer Leserschaft. Der größte Fehler, den eine Zeitung machen kann, besteht darin, dass sie dieses gewachsene Vertrauen durch mehr oder weniger abrupte Kursänderungen journalistischer, verlegerischer oder scheinbar ökonomischer Natur aufs Spiel setzt. Digitale Reichweite kann man heute durch allerlei Machinationen vergrößern. Verlorenes oder verloren gehendes Vertrauen nicht. In Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman „Der Leopard“ rät der junge Neffe seinem melancholischen, sich von den neuen Zeiten bedroht fühlenden Onkel: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann muss sich alles verändern.“ In der SZ, der manchmal melancholischen Achtzigjährigen, wird in den nächsten zehn Jahren nicht viel bleiben können, was vor zehn Jahren noch war. Andernfalls wird es zum Hundertsten keine Jubiläumsartikel mehr geben.
Zeitung als Heimat, als moralische Anstalt, als Demokratieerhalterin? Es mag sein, dass solche Sätze in einer Zeit, in der alles benörgelt, alles ironisiert wird, altbacken, nostalgisch und moralisierend klingen. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht wenige SZ-Leserinnen und -Leser, die Tests von Handmixern, Geschichten über Wandererlebnisse mit dem Hund, digitale Sex-Kolumnen oder Serien über „Kraftorte“ nicht unbedingt mit ihrer Vorstellung von „ihrer“ Zeitung vereinbaren können. Die Zeitung hat sich sehr verändert, angefangen damit, dass heute zu ihrer Existenz auf Papier stets die nüchterne Frage gehört: Wie lange noch? Wie lange noch jeden Tag gedruckt von Montag bis Samstag?
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Vor zwanzig Jahren, da feierte die SZ ihren 60., lag die verkaufte Auflage im zweiten Quartal 2005 zwischen Montag und Samstag bei 444 440 Exemplaren. Täglich. Man verkaufte auch damals schon ein E-Paper, für das sich 4207 Käufer fanden. Zehn Jahre später, 2015, zählte man noch 344 406 Print-Abos; das E-Paper beziehungsweise die seit einigen Jahren neu gebaute digitale Zeitung war auf 38 397 gestiegen. Heute, 2025, liegt die Printauflage bei 150 474. Fast 300 000 Zeitungen weniger als vor 20 Jahren. Dafür kommt die SZ digital auf 300 578. Es ist schön, dass die digitale Auflage so steigt. Leider bringt ein Digitalabo deutlich weniger ein als ein Printabo. Eine Redaktion wie die der SZ zu unterhalten, ist teuer. Verkleinert man sie merklich, ist es nicht mehr die SZ.
Wie lange Zeitungen noch auf Papier gedruckt werden, weiß niemand. Die digitale Revolution hat viele Lebensgewohnheiten radikal verändert. Bis in die Nullerjahre des 21. Jahrhunderts war die Zeitung auf Papier Lebensbegleiter vieler Menschen – sei es in der Form des Boulevardblatts mit großen Lettern und kleinen Skrupeln, sei es als Lokalblatt mit Verwurzelung in einer Stadt und örtlicher Fußballberichterstattung, sei es als überregionale Zeitung mit viel Text, moralischen Bedenken gegen alles Mögliche und Büros in Berlin, Washington und Moskau. Man konnte, wenn man sah, was eine oder einer im Bus, im Café oder in der S-Bahn las, auch darauf schließen, welchem Milieu er angehörte, und manchmal auch darauf, wo er oder sie politisch stand.
Heute liest kaum jemand mehr Zeitungen in der Bahn oder im Café. Die Leute schauen in ihr Mobiltelefon, immer und überall. Das Smartphone ist das zentrale Kommunikationsgerät geworden. Mehr noch: Es ist der Tagesbegleiter und bei vielen der Tagesbestimmer. Manche beschäftigen sich ein paar Minuten lang auch mit den Webseiten der SZ, der FAZ oder der Zeit, der „Tagesschau“ oder des Spiegel. Das sind aber im unübersehbaren Chor dessen, was man alles aus dem Netz tönen lassen kann, nur einzelne Stimmen. Das Oligopol der Information, Themenauswahl, Bewertung und Erklärung, das Rundfunk und Fernsehen, Zeitungen und Magazine lange hatten, gibt es so nicht mehr. Jeder ist im Netz sein eigener Gatekeeper – wenn diese Aufgabe nicht längst ein Algorithmus übernommen hat.
Zwar ergeben Umfragen immer noch, dass die sogenannten etablierten Medien Glaubwürdigkeit und Vertrauen genießen. Das ist gut, und es ist wichtig für die Zukunft dieser Medien, auch für die der SZ. Und dennoch wird es deutlich schwieriger werden, in den nächsten zwanzig Jahren eine gute, anspruchsvolle und wirtschaftlich halbwegs erfolgreiche Zeitung zu „machen“, als es dies in all den Jahren zwischen 1950 und 2010 war. Nein, leicht war es in diesen Jahrzehnten auch nicht. Aber es gab die als sicher erscheinende Grundlage: Eine gut gemachte Zeitung, gedruckt auf Papier, lässt sich mit Anzeigen und Abonnements sowie den Erlösen aus dem Einzelverkauf finanzieren. Diese Grundlage ist perdu.
Eine Zeitung wie die SZ wird auch heute noch ökonomisch zu erheblichen Teilen von den Abonnements der Printleser getragen. Die meisten der Leser und Leserinnen mit Print-Abos gehören der sogenannten Boomer-Generation an; nicht wenige der Abonnenten sind älter als die SZ selbst. Sie sind als Printleserinnen und Zeitung-im-Briefkasten-Haber aufgewachsen und für sie gehört „ihre“ Zeitung immer noch zu ihrem Leben. Viele von ihnen nutzen die SZ auch digital, bleiben aber dem Gedruckten treu trotz mancherlei Unmuts (zu dünn, zu wenig Lokales, zu wenig Konzertkritiken, zu viel Betroffenheitsgelaber). Möge Gott, der älter ist als alle Boomer und selbst als Jürgen Habermas und auch deswegen ein Zeitungsleser sein könnte, dafür sorgen, dass die Boomer noch lange leben. Und möge er den Verlagsgeschäftsführern und Digitaltransformationsoffizieren die Erkenntnis schenken, dass man trotz allem bei einer Vernachlässigung der gedruckten Zeitung etwas verliert, was man nie wieder gewinnt.
Die Art der Verbreitung entscheidet nicht über die Qualität des Verbreiteten
Aber die Zukunft der Zeitung kommt nicht aus den Druckmaschinen. Zwar wird es die gedruckte Zeitung noch länger geben, als manche befürchten. Die Qualität dessen, was die SZ all die Jahrzehnte ausgemacht hat, hängt glücklicherweise nicht davon ab, ob man einen Text auf Papier, auf dem Tablet oder auf dem Telefon präsentiert. Eine gut geschriebene Reportage, ein präzise argumentierender Leitartikel, eine originelle Analyse, eine ironische Glosse, ein Feuilletonaufsatz, bei dem nicht der Autor, sondern die Idee im Mittelpunkt steht – all diese Texte bleiben interessant, lesenswert, auch unterhaltsam, egal ob sie mit dem Federkiel, der Schreibmaschine oder dem Laptop geschrieben wurden. Und dasselbe trifft auf das Medium zu: Ein Bildschirm ist eine Zeitungsseite ist ein E-Reader und wird demnächst irgendetwas sein, von dem wir noch nicht wissen, dass wir in sieben Jahren mit ihm Texte lesen.
