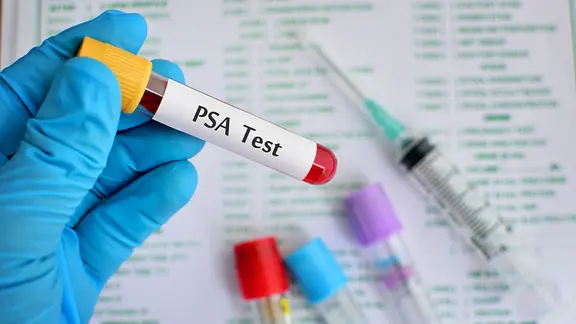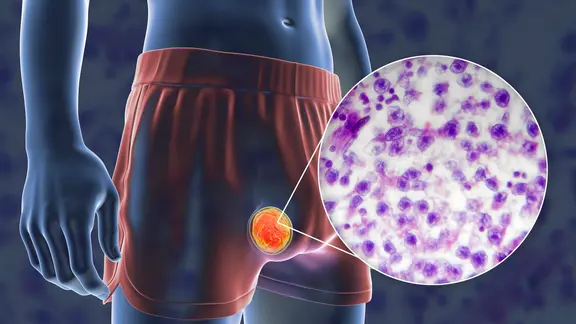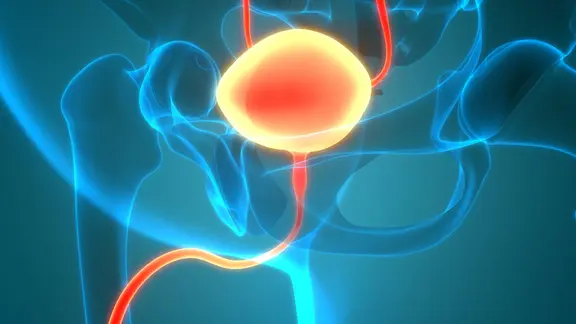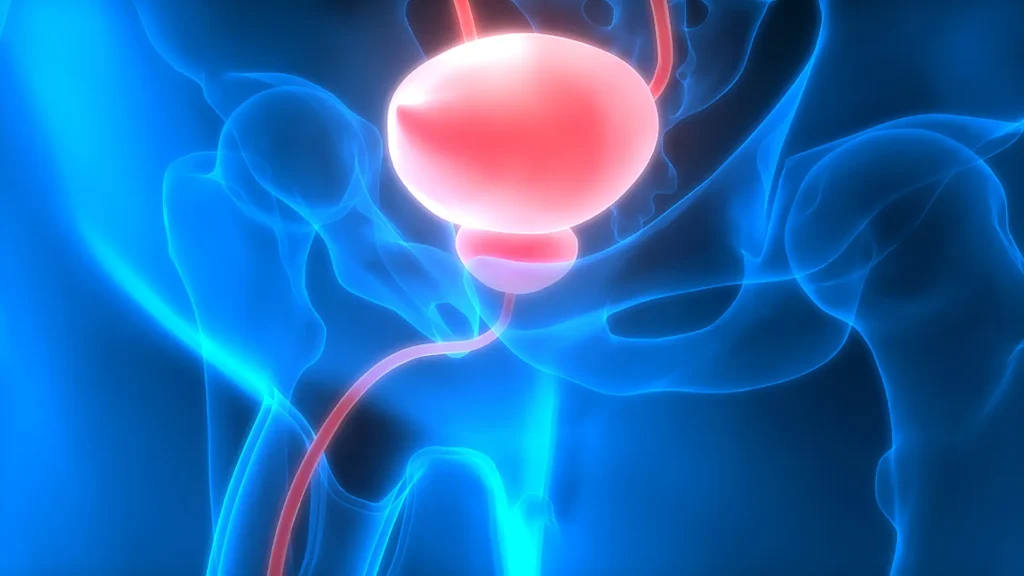
Stand: 30.09.2025 19:55 Uhr
| vom
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Doch Symptome für ein Prostatakarzinom zeigen sich meist erst in fortgeschrittenem Stadium. Moderne Verfahren ermöglichen oft eine schonende Behandlung.
Die genaue Ursache für die Entstehung eines Prostatakarzinoms ist nicht geklärt, aber mehrere Risikofaktoren sind bekannt: Der wichtigste Risikofaktor für Prostatakrebs ist das Alter. In Europa wird ein Prostatakarzinom gewöhnlich bei Männern über 65 Jahren diagnostiziert, es kann aber bereits in jüngeren Jahren auftreten. Jährlich erkranken in Deutschland über 70.000 Männer an Prostatakrebs, 15.000 sterben daran. Wichtig zu wissen: Nicht jedes entdeckte Prostatakarzinom bedarf der Therapie.
Die ethnische Zugehörigkeit spielt eine Rolle, denn Männer mit dunkler Hautfarbe haben ein doppelt so hohes Risiko Prostatakrebs zu entwickeln wie Männer mit heller Hautfarbe. Asiatische Männer haben dagegen ein geringeres Risiko. Ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs kann auch genetisch bedingt sein.
Wer nahe Verwandte hat, bei denen im Alter unter 60 Jahren Prostatakrebs festgestellt wurde, sollte über geeignete Maßnahmen zur Früherkennung mit seiner Ärztin oder seinem Arzt sprechen. Und schließlich scheint auch die Ernährung ein Faktor zu sein, denn Männer mit Übergewicht oder Adipositas haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko, ein Prostatakarzinom zu entwickeln.
Prostatakrebs: Symptome meist nicht im Frühstadium
Anfangs verursacht ein Prostatakrebs nicht unbedingt Symptome. In der Regel wird er nur zufällig oder bei der Untersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs entdeckt. Bei weiter fortgeschrittenem Prostatakrebs können unterschiedliche Symptome auftreten. Dazu gehören:
- Probleme beim Wasserlassen
- schwächerer Harnstrahl
- Blut im Harn
- Blut im Sperma
- Knochenschmerzen (meist im Rücken)
- unbeabsichtigter Gewichtsverlust
- Schwierigkeiten, den Stuhlgang zu kontrollieren
- Erektionsstörung, auch als erektile Dysfunktion oder Potenzstörung bezeichnet
Probleme beim Wasserlassen und ein schwacher Harnstrahl sind meist eher durch eine gutartige Vergrößerung der Prostata, die benigne Prostatahyperplasie (BPH), bedingt. Bei einem Prostatakrebs treten diese Symptome dagegen erst spät auf.
Früherkennung von Prostatakrebs: Neue Leitlinie empfiehlt keine Tastuntersuchung mehr
Zur Früherkennung von Prostatakrebs wurde Männern bisher empfohlen, ab einem Alter von 45 Jahren jährlich einmal eine rektale Tastuntersuchung vornehmen zu lassen. Die Untersuchung ist seit 1971 Teil des Früherkennungsprogramms der gesetzlichen Krankenkassen. Es ist im Moment noch die einzige Früherkennungsmaßnahme, die von den Krankenkassen bezahlt wird. Dabei führt die Ärztin oder der Arzt einen Finger in den Enddarm ein, um die Prostata abzutasten. Diese Untersuchung ist normalerweise nicht schmerzhaft, allenfalls spürt der Patient etwas Druck und einen kurzen Harndrang.
Allerdings gilt die diagnostische Aussagekraft der rektalen Tastuntersuchung seit Langem als gering. Der untersuchende Finger erreicht nur die Rückseite der Prostata. Vor allem kleine Tumoren im Frühstadium sind bei der Untersuchung häufig noch nicht zu ertasten und bleiben unentdeckt. So wiegen sich Untersucher und Untersuchte in falscher Sicherheit. Und es gibt eine sehr hohe sogenannte Falsch-Positiv-Rate. Das heißt, verdächtige Befunde, die ertastet wurden, stellten sich nach weiterer Diagnostik als harmlos heraus. Männer würden laut Expertinnen und Experten dadurch unnötig in Angst vor Prostatakrebs versetzt und einer unnötigen Untersuchung ausgesetzt.
Außerdem stößt die Tastuntersuchung auf nur geringe Akzeptanz bei den Männern. Viele nehmen allein deshalb nicht am Programm zur Früherkennung von Prostatakrebs teil. Eine Auswertung der Barmer Ersatzkasse aus dem Jahr 2019 zeigte, dass nur rund zwölf Prozent der Männer das Angebot nutzen. Die neue Leitlinie empfiehlt die Tastuntersuchung nicht mehr für die Früherkennung von Prostatakrebs, sondern den PSA-Test in Kombination mit möglichen weiteren Untersuchungen.
PSA-Test und MRT zur Diagnose von Prostatakrebs
Als wichtigste Maßnahme zur Früherkennung gilt nach der neuen Leitlinie jetzt die Bestimmung des PSA-Wertes. PSA (Prostataspezifisches Antigen) ist ein Eiweiß, das nur von der Prostata hergestellt wird. Sein biologischer Nutzen ist es, das Sperma nach dem Ausstoß zu verflüssigen, damit die Spermien besser zu den Eierstöcken gelangen können. Das PSA tritt ins Blut über und lässt sich dort mittels eines einfachen Bluttests im Labor nachweisen. Verschiedene Faktoren erhöhen den PSA-Wert im Blut. So steigt er bei Prostatakrebs an, aber auch bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata. Auch intensives Radfahren kann das PSA im Blut erhöhen, so wie sexuelle Aktivität oder Entzündungen. Alle diese Einflussfaktoren müssen bei der Begutachtung von PSA-Werten mit einbezogen werden. Einmal erhöhte PSA-Werte sollen kontrolliert werden, bevor weitergehende Maßnahmen eingeleitet werden.
Nach den neuen Empfehlungen sollte jeder Mann ab etwa 45 Jahren einen PSA-Test vornehmen lassen. Je nach Ergebnis werden verschiedene weitere Maßnahmen zur Früherkennung empfohlen:
- Ist der Wert unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml), dann ist der nächste PSA-Test erst nach fünf Jahren notwendig.
- Liegt der Wert bei 1,5 -3 ng/ml sollte man schon nach zwei Jahren erneut testen.
- Über 3 ng/ml sind weitere Untersuchungen empfohlen.
Bisher folgte auf erhöhte PSA-Werte gleich eine Biopsie, bei der mit einer Nadel Gewebeproben aus der Prostata entnommen werden. Jedoch erwiesen sich viele dieser Biopsien als unnötig.
Jetzt soll auf erhöhte PSA-Werte erstmal eine spezielle MRT-Untersuchung der Prostata folgen. Das multiparametrische MRT, ein nicht-invasives radiologisches Bildgebungsverfahren, zeigt verdächtige Bereiche an und lässt auch Aussagen darüber zu, ob weitere Diagnostik notwendig ist oder nicht. Bei abklärungsbedürftigen Befunden im MRT folgt eine sogenannte Fusionsbiopsie. Dabei werden die MRT-Aufnahmen verwendet, um gezielt die verdächtigen Bereiche der Prostata zu untersuchen. Die Treffgenauigkeit der Biopsie steigt dadurch deutlich. Die Expertinnen und Experten sind sich sicher, dass mit den neuen Empfehlungen ein Übermaß an Diagnostik und Therapien verringert wird.
Noch sind die empfohlenen Untersuchungen keine Kassenleistungen, Männer müssen dafür selbst bezahlen. Ein PSA-Test in der urologischen Praxis kostet 35 bis 55 Euro, eine spezielle Prostata-MRT-Untersuchung 500 bis 1.000 Euro. Eine Neubewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) ist beantragt. Fachleute rechnen damit, dass Krankenkassen in etwa zwei Jahren die Kosten für die empfohlenen Früherkennungsuntersuchungen auf Prostatakrebs übernehmen werden.
Verschiedene Stadien bei Prostatakrebs
Um die Strategie für die optimale Behandlung festlegen zu können, muss zunächst geklärt werden, wie groß der Tumor ist, wie weit er sich bereits ausgebreitet hat und wie aggressiv das Prostatakrazinom ist. Dazu dient die Einteilung in Tumorstadien:
- Im Stadium 1 (T1) ist der Tumor noch klein und lediglich an einem Ort in der Prostata zu finden. In diesem Stadium ist Prostatakrebs noch zu klein, um bei der Tastuntersuchung oder einer bildgebenden Untersuchung entdeckt zu werden.
- Im lokal begrenzten Stadium 2 (T2) ist der Tumor noch immer klein und auf die Prostata beschränkt, aber bereits tastbar.
- Im lokal fortgeschrittenen Stadium 3 (T3) ist der Tumor durch die Wand der Prostata gewachsen und es können sich Krebszellen in der direkten Nachbarschaft ausgebreitet haben (Metastasen).
- Im Stadium 4 (T4) ist der Tumor außerhalb der Prostata gewachsen. Tumorzellen haben sich zum Beispiel in der Blase, im Mastdarm oder im Beckenboden gebildet.
Ein Prostatakarzinom kann darüber hinaus in die Lymphknoten, die Knochen und Organe wie Leber, Lungen und Gehirn streuen und dort Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden. In diesem Fall spricht man von einem metastasierten Prostatakarzinom.
Wachstum von Prostatakrebs: Einstufung durch Tumorgrad
Während die Stadien von Prostatakrebs Auskunft über die Tumorgröße und die Ausbreitung der Krebszellen geben, bezeichnen die sogenannten Tumorgrade, wie schnell der Krebs wachsen und streuen könnte. Dabei weist ein niedrigerer Tumorgrad auf einen langsamer wachsenden und ein höherer auf einen schneller wachsenden Krebs hin. Beim Prostatakarzinom wird zur Einteilung vor allem der sogenannte Gleason-Score verwendet. Er wird nach der pathologischen Untersuchung des bei der Biopsie entnommenen Tumorgewebes festgelegt. Eine andere Einstufung ist die ISUP-Klassifikation.
Behandlung von Prostatakrebs: Therapien im Überblick
Früh erkannt ist Prostatakrebs viel besser behandelbar als bei später Diagnose. Die wichtigsten Therapieverfahren sind:
- aktives Überwachen (Active Surveillance)
- minimalinvasive, roboterassistierte oder offene OP zur Entfernung der Prostata
- Brachytherapie (interne Bestrahlung)
- externe Bestrahlung
- Hormontherapie (bei weit fortgeschrittenem oder schon metastasierendem Prostatakrebs)
Manche Prostatakrebsarten können über viele Jahre „ruhen“ und nicht zu Beschwerden, Metastasen oder zum Tod führen. Viele Männer können mit einem Prostatakrebs alt werden, ohne zu erkranken. Es kann ausreichen, die Entwicklung abzuwarten und erst dann eine Behandlung einzuleiten, wenn die Erkrankung fortschreitet. Deshalb kommt es darauf an zwischen solchen harmlosen und gefährlichen Krebserkrankungen zu unterscheiden.
Bei behandlungsbedürftigen Prostatakarzinomen wird meist die gesamte Prostata behandelt, also vollständig entfernt oder bestrahlt. Das ist erforderlich, weil in mehr als 80 Prozent der Fälle bereits viele kleine Tumorherde über das gesamte Organ verteilt sind (multifokaler Tumor). In einigen Fällen, wenn der Tumor auf nur einen Tumorherd oder ein einzelnes Areal begrenzt zu sein scheint, kann auch eine sogenannte fokale Therapie erwogen werden, bei der nur der Tumorherd oder das betroffene Areal der Prostata behandelt wird. Bei fortgeschrittenen Erkrankungen kommt ein neues Verfahren zum Einsatz, die Endoradiotherapie. Dabei wird der Tumor von innen mit einem radioaktiven Medikament bestrahlt.
Lebenserwartung bei Prostatakrebs
Wird das Prostatakarzinom früh entdeckt, ist der Krebs heilbar. Wird die Erkrankung erst spät entdeckt und nicht gestoppt, breitet sich der Krebs aus. Das metastasierte Prostatakarzinom ist nicht heilbar. Bei der palliativen Behandlung steht die Bekämpfung der Schmerzen durch die Metastasen im Mittelpunkt. Wie lange Betroffene überleben, hängt von der Aggressivität des Krebses ab und wo sich die Metastasen im Körper befinden. Nicht selten können Männer auch mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom, dank des medizinischen Fortschritts, noch viele Jahre gut leben.