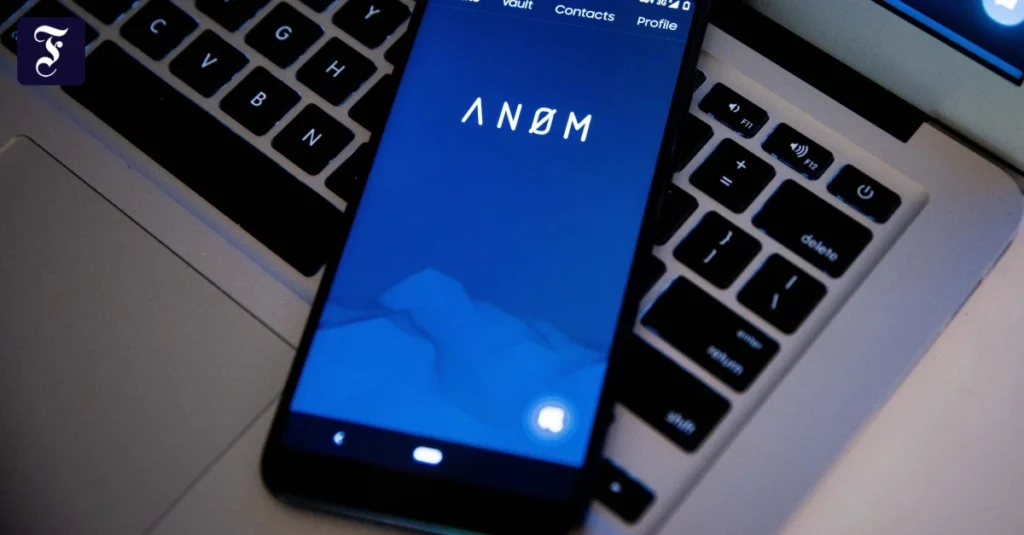

Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde eines verurteilten Drogenhändlers abgewiesen, der sich gegen die Nutzung von Chats des Kryptodiensts Anom als Beweismittel gewandt hatte. Es gebe keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Verwertung, schreiben die Richter in ihrem Beschluss. Dieser stammt vom 23. September, wurde aber erst an diesem Mittwoch veröffentlicht. In der Zwischenzeit haben Recherchen der F.A.Z. gezeigt, dass die weltweite Operation rund um Anom auf einem fragwürdigen Gerichtsbeschluss aus Litauen beruhte.
Die Handys mit dem verschlüsselten Anom-Messenger waren von der amerikanischen Bundespolizei FBI im kriminellen Milieu vermarktet worden. Vor allem Drogenhändler nutzten auf ihnen den Kryptodienst Anom und ahnten nicht, dass ihre Nachrichten auch bei den Sicherheitsbehörden landeten. Mehr als 12.000 Geräte waren laut FBI zum Ende der Operation im Juni 2021 im Umlauf.
Die deutschen Ermittlungsbehörden erhielten die so abgefangenen Daten später per Rechtshilfe aus den USA. Den richterlichen Beschluss, der der Operation zugrunde lag, hielten die US-Behörden genauso geheim wie das Land, in dem er ergangen war. Diese „Erkenntnisdefizite“ beträfen aber nur die Frage, ob die Speicherung und die Weitergabe der Anom-Daten an die USA nach dem nationalen Recht des unbekannten Landes zulässig gewesen seien, schreiben die Verfassungsrichter. Und das sei für die Frage eines Beweisverwertungsverbotes in Deutschland nicht von Bedeutung. Die Beschwerde des Mannes, der vom Landgericht Mannheim wegen Drogenhandels zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, nahm das Verfassungsgericht deshalb gar nicht erst zur Entscheidung an.
Grundsätzlich kann es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts durchaus sein, dass Beweise, die deutsche Behörden per Rechtshilfe erhalten, in Strafverfahren vor Gericht nicht genutzt werden dürfen. Das ist laut dem Beschluss der Fall, wenn sie in einem anderen Land „unter Außerachtlassung nationaler und europäischer rechtsstaatlicher Mindeststandards gewonnen worden sind“. Ähnlich hatte Anfang des Jahres auch der Bundesgerichtshof (BGH) geurteilt. Wie der BGH verweist auch das Bundesverfassungsgericht auf den „Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens“. Demnach geht die deutsche Justiz grundsätzlich davon aus, dass Beweise im Ausland unter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zustande gekommen sind – solange diese Annahme nicht durch „entgegenstehende Tatsachen erschüttert wird“.
Was den Verfassungsrichtern zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung nicht vorlag, sind sowohl die Anfang dieser Woche veröffentlichten Recherchen der F.A.Z. sowie die zugrunde liegenden Dokumente. Dabei handelt es sich um geheime Akten und Hunderte Seiten interner E-Mails, die neben der F.A.Z. auch dem finnischen Sender Yle und der litauischen Nachrichtenseite 15min zugespielt wurden. Um den notwendigen Beschluss für das Abfangen der Anom-Daten zu erwirken, arbeitete das FBI demnach eng mit litauischen Strafverfolgern zusammen. Laut den Dokumenten täuschten die Ermittler der zuständigen Richterin in Vilnius einen falschen Sachverhalt vor und verschwiegen ihr bewusst, dass es das FBI selbst war, das Anom entwickelt und vermarktet hatte.
Laut der Einschätzung eines Strafrechtsexperten könnte diese Täuschung auch Folgen für Deutschland haben, wo auf der Grundlage der Anom-Chats bislang mehr als 860 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt, dem die F.A.Z. ihre Rechercheergebnisse geschildert hat, hält es sogar für möglich, dass rechtskräftig abgeschlossene Gerichtsverfahren wiederaufgenommen werden müssen. „Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sich die deutsche Justiz hat hinters Licht führen lassen, dann muss das zumindest geprüft werden“, sagte er der F.A.Z. „Wenn in einem Strafverfahren entscheidende Tatsachen einem Richter gegenüber bewusst unterdrückt werden, widerspricht das EU-Recht, ganz ohne Zweifel.“
In ihrem am Mittwoch – also zwei Tage nach der F.A.Z.-Recherche – veröffentlichten Beschluss weisen die Verfassungsrichter in einem eigenen Absatz explizit darauf hin, dass ihnen auch über die konkrete Beschwerde hinaus „bislang keine Erkenntnisse“ vorlägen, die Anhaltspunkte für die Annahme bieten könnten, dass die Anom-Chats einem Beweisverwertungsverbot unterlägen.
Ob die Täuschung des Gerichts in Vilnius, die von der F.A.Z. öffentlich gemacht worden ist, solch ein Anhaltspunkt sein könnte, wird sich zeigen. Noch immer werden Dutzende Anom-Verfahren vor deutschen Gerichten geführt. Es könnte also gut sein, dass die Richter in Karlsruhe sich noch einmal mit dem Thema befassen müssen.
